von Peter Achten / Quelle: news.ch / Montag, 15. November 2010 / 15:41 h
Dass Xi im Ausland, zum Teil aber auch in China wenig bis gar nicht bekannt ist, bildet international unter Politikern ja keine Ausnahme. US-Präsident Barak Obama war zwei Jahre vor seiner Wahl in Europa so gut wie unbekannt. Und Kim Jong-un – Enkel des nordkoreanischen «Präsidenten in alle Ewigkeit» Kim Il-song und Sohn des «Geliebten Führers» Kim Jong-il – kannte bis vor Kurzem ausser seinen Schulfreunden in Köniz (Kanton Bern) ausserhalb des hermetisch abgeschlossenen kommunistisch-stalinistischen Königreichs Nordkorea niemand. Und doch soll er der künftige König sein.
In China freilich ist, was die Nachfolge betrifft, alles anders. Weder wird wie in den USA gewählt, noch gelten wie in Nordkorea geradezu klassische dynastische Regeln. Nun ist selbst in der Volksrepublik China Xi Jingping noch wenig bekannt. Er ist zwar im allmächtigen ständigen Ausschuss des Politbüros – dort wo alle Entscheidungen abschliessend gefällt werden – unter neun Männern bereits die Nummer sechs. Dazu bekleidet er das Amt des Vize-Staatspräsidenten. Doch beim Laobaixing, dem Mann und der Frau auf der Strasse, ist Xis Frau Peng Liyuan sehr viel bekannter. Peng nämlich kann nicht nur bezaubernd lächeln, sie kann auch singen und ist wegen ihrer süss-kitschigen Volkslieder beliebt bei Jung und Alt.
In die Spitze der 80 Millionen Mitglieder starken Kommunistischen Partei Chinas zu gelangen, ist nicht einfach. Längst sind die Zeiten des «Grossen Steuermanns» Mao Dsedong vorbei, als ideologische Treue den Ausschlag gab, wo es also wichtiger war, rot zu sein, anstatt Experte. Heute macht nur noch Karriere, wer gut ausgebildet ist. Kein Wunder deshalb, dass in der obersten chinesischen Führungsriege praktisch alle ein Studium, meist als Ingenieur, absolviert haben. So schloss auch Xi Jinping an der renommierten technischen Hochschule Qinghua in Peking – der ETH Chinas sozusagen – als Ingenieur ab und doktorierte danach in ländlicher Agronomie.
Als Parteichef in den Boom-Provinzen Fujian und Zhejiang sowie in Shanghai zeichnete er sich als reformfreudiger Kader aus. Doch um ganz nach oben zu kommen, reichen solch professionellen Referenzen auch in einer modernen Meritokratie wie China nicht immer. Xi Jinping hatte Glueck. Sein Vater nämlich war ein Revolutionär der ersten Stunde, war mit wichtigen Staatsämtern beauftragt und wurde während der Grossen Proletarischen Kulturrevolution (1966-76) kaltgestellt.
Xi Jingping gehört, um es auf Partei-Chinesisch auszudrücken, zur Fraktion der «Prinzlinge», das heisst den Kindern hoher und höchster Partei-Funktionäre. Das hat Xi in seiner Karriere gewiss auch geholfen, beziehungsweise nicht geschadet.
Die Nachfolgefrage wurde seit der Gründung der Volksrepublik 1949 unterschiedlich gelöst. Kurz vor seinem Tod 1976 soll der Grosse Vorsitzende Mao zu seinem Helfer, dem obskuren Hua Guofeng gesagt haben: «Mit Dir am Ruder ist mir wohl ums Herz». Hua, ein Mao-Orthodoxer, wurde dann drei Jahre später zu Beginn der Wirtschafts-Reform vom grossen Revolutionaer und Übervater der Reform, Deng Xiaoping, entmachtet.



Zwei mit Ambitionen auf den Chefposten: Der deutsche Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg und Xi Jinping - «Prinzling» und vielleicht bald neuer roter Kaiser. /
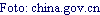

Deng, der danach hinter den Kulissen bis 1997 die Fäden zog, ohne je formell ein ganz hohes Amt innezuhaben, bestimmte die obersten Chargen, zumal die Position des Chefs der allmächtigen Kommunistischen Partei.
Doch Deng hatte zunächst mit seinen Personalentscheiden wenig Glueck. Der beim Volk beliebte Parteichef Hu Yaobang musste 1987 nach ersten Studentenprotesten in Hefei (Provinz Anhui) seinen Hut nehmen, blieb aber – was noch wenige Jahre zuvor undenkbar war – im Zentralkomitee. Nachfolger Zhao Zyiang stürzte 1989, weil er den auf dem Platz vor dem Tor des Himmlischen Friedens Tiananmen demonstrierenden Studenten zuviel Sympathie entgegenbrachte. Ungleich seinem Vorgänger wurde Zhao aus dem ZK ausgeschlossen und blieb bis zu seinem Tode unter Hausarrest.
Reformer Deng liess 1989, mitten in einer Wirtschaftskrise, den studentischen, von Arbeitern, Angestellten und Beamten unterstützten Protest gewaltsam unterdrücken. Deng befürchtete Chaos, wie viele Kaiser zuvor. Deng allerdings hatte noch die Kulturrevolution in Erinnerung, die für das chinesische Volk eine Katastrophe war, er wollte keine Wiederholung. Um die Wirtschaft zu entwickeln und dem Volk Wohlstand zu bringen, so Dengs Argument, brauche es Stabilität und Disziplin. Der Shanghaier Parteichef Jiang Zemin wurde von Deng nach Peking berufen. Danach wurde das Amt des Parteichefs mit dem Amt des Staatschefs verbunden, und schliesslich kam das allerwichtigste Amt hinzu, jenes nämlich des Vorsitzenden der Militärkommission.
Deng bestimmte noch vor seinem Tod 1997 den damals noch jungen Parteimann Hu Jintao zum Nachfolger Jiangs. Seither wird der Rote Kaiser alle zehn Jahre neu bestimmt. Das steht zwar nirgends in Parteiverfassung, hat sich aber im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts als stabilitätsförderndes Faktum herausgebildet. So wurde Hu Jintao 2002 zum Parteichef, 2003 zum Staatschef und 2004 zum Vorsitzenden der Militärkommission ernannt. Die erste normale, friedliche Machtübergabe der Volksrepublik. Und alles sieht so aus, als ob sich das wiederholen wird. Nach dem gleichen Muster.
Xi Jinping ist also auf dem besten Weg, Hu Jintao abzuloesen. Immerhin ist Xi – wie Hu vor ihm – bereits Vize-Staatschef. Mitte Oktober wählte dann das ZK Xi zu einem der Stellvertretenden Chefs der Militärkommission. Am nächsten Parteitag 2012 wird Xi Jinping mithin wohl zum Parteichef, 2013 zum Staatschef und 2014 zum Vorsitzenden der Militärkommission gekürt. Wenn alles gut geht. In der Partei nämlich gibt es seit Beginn der Reform vor über dreissig Jahren verschiedene Fraktionen, die um die politischen und wirtschaftlichen Prioritäten ringen. Xi Jinping gehört zu den «Stillen», er gilt als Vermittler. Beste Voraussetzungen um als nächster Roter Kaiser gekürt zu werden.
Den Namen Xi Jingping sollte man sich also merken. Denn wer China mit der weltweit zweitgrössten Volkswirtschaft, der grössten Armee, mit gigantischen Umweltproblemen und viel sozialem Zündstoff führen wird, muss für die internationalen Gemeinschaft von höchstem Interesse sein.