|
Samstag, 9. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Die Krise nach der KriseMomentan redet jeder von der Krise. Doch seien wir ehrlich: die gegenwärtige Wirtschaftskrise ist eine psychologische, eine des Vertrauens und eine Angstkrise. Es geht um imaginäre Werte in durch Übereinkünfte, aber nicht durch die physische Realität erschaffenen Systemen.Patrik Etschmayer / Quelle: news.ch / Freitag, 2. Dezember 2011 / 12:00 h
Ganz konkret ist die momentane Trockenheit in vielen Gegenden Mitteleuropas die im Krassen Gegensatz zu den Flutereignissen im Süden des Kontinents steht. Ja, es sind weltweit die klimatischen Eckpfeiler daran, sich zu bewegen. Die zu erwartende Untätigkeit der Teilnehmer der Klimakonferenz in Durban, wo sich alle einig zu sein scheinen, dass es in Zeiten der ökonomischen Krise zu teuer ist, sich mit einer klimatischen ernsthaft auseinander zu setzen, wird auch nichts daran ändern.
Ebenso lässt die Tatsache, dass soeben wieder Rekordmengen an CO2 in die Atmosphäre entlassen worden sind, nicht an eine Wende glauben; genau so wenig wie die immer noch wachsende Weltbevölkerung.
Dabei ist nicht nur ein allfälliger Wandel des Klimas ein Problem, sondern auch das Wissen, wie genau sich dieser manifestiert. Die Statistiken weisen darauf hin, dass viele Vorhersagen von Klimawissenschaftlern von vor 10, ja 20 Jahren heute Wirklichkeit geworden sind und deshalb vermutlich zuverlässig sind.
So trafen denn die Voraussagen, dass es mehr Hitzeperioden (wie zum Beispiel in Russland) geben werde, ebenso wie jene, dass sowohl Dürren als auch Überflutungen regelmässiger stattfänden (Italien, USA) leider ein. Das durch Gletscherschwund und zusätzliche Verdunstung freigesetzte Wasser sorgt in der Wettermaschinerie für zusätzliche Energie.
Der Streit über die Ursache wird bestehen bleiben, doch der Fakt des Klimawandels ist unbestritten. Die Frage ist, wie wir uns daran anpassen sollen. Und dies muss auf einer nationalen Ebene geschehen.
In der Schweiz dürften wir mit vielen Trockenperioden (wie derzeit und im vergangen Spätwinter und Frühling), Starkregenereignissen und einer allgemeinen Erwärmung, welche diversen Bäumen in den Wäldern nicht gut bekommen dürfte konfrontiert werden.
Egal, was in der Klimapolitik läuft, es müssen aus diesen offenbar unvermeidlichen Tatsachen Konsequenzen gezogen werden.
Fast ausgetrockneter Sihlsee: Bald schon die Regel? /
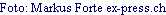 So müsste es für die Sicherung der Wasserversorgung - sowohl Trinkwasser als auch für die Bewässerung - wesentlich mehr Rückhaltebecken und Stauseen geben, die - wenn überhaupt - nur Sekundär für die Energiegewinnung genutzt würden. Diese Becken wären auch in der Lage, bei Unwettern als Puffer zumindest für eine gewisse Zeit Wassermassen aufzunehmen und Überschwemmungen zu verhindern. In den Wäldern müsste jetzt schon begonnen werden, Bäume zu pflanzen, die eine grössere Dürre-Resistenz aufweisen und mit den neuen Klimabedingungen besser zurecht kommen als die momentan wachsenden, «gemässigten» Bäume. Eine natürliche Ablösung dauert eindeutig zu lange. Auch die Energieversorgung ist vom Wetter abhängig. Sowohl Flusswasserkraftwerke als auch AKW's sind darauf angewiesen, dass der Wasserstand der Flüsse ein gewisses Niveau einhält. Fehlt bei einem AKW das Kühlwasser, muss der Ofen ausgeschaltet werden und bei einem Flusskraftwerk geht auch nix mehr. Und viele Kleinkraftwerke würden wegen Wassermangel (wie auch in diesem Spätherbst) still stehen. Öl- und Gas-Kraftwerke sind - angesichts der Tatsache, dass die Energielieferanten für solche Kraftwerke meist recht problematisch sind und dass das Klima-Problem vermutlich erst durch deren Abgase verursacht wurden, nicht wirkliche Alternativen, so dass in der Schweiz vor allem Tiefen-Geothermie-, Pumpspeicherkraftwerke und ein wenig Solar- und Windenergie zur Verfügung stünden. Ein Energiemix, der heute noch nicht wirklich die Butter aufs Brot zaubern würde und deren Ausbau mit grossem Risiko und eben solchen Investitionen voran getrieben werden müsste. Tönt alles ziemlich heftig? Ja, tut es, aber sowohl die ökonomische als auch die klimatische Krise erfordern einen erheblichen Umbau, dessen, was ist, zu dem, was wir in Zukunft benötigen. Doch statt Pläne für das Verwirklichbare anzugehen, drehen sich Politik und Wirtschaft im Kreis und reden nur noch von der Krise, der Krise nach der Krise, der Krise nach jener und sorgen so dafür, dass diese auch Eintreffen werden. Links zum Artikel:
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|