Es ist ein gewagtes Spiel. Mit der Schaffung einer eigenen chinesischen Luftverteidigungszone (AIDZ) verändert China die Einsatzregeln für seine Streitkräfte und gleichzeitig den heiklen Status quo im Ostchinesischen Meer.
Damit wächst die Gefahr einer Konfrontation zwischen chinesischen und japanischen Militärflugzeugen im Luftraum über dem umstrittenen Meeresgebiet. Ein solcher Zwischenfall könnte der Zündfunke für einen militärischen Konflikt in Ostasien werden, in den zwangsläufig auch die USA als Sicherheitspartner Tokios hineingezogen werden könnten.
In der neuen Zone droht China mit militärischen Gegenmassnahmen, falls sich ausländische Flugzeuge nicht zu erkennen geben oder deren Piloten die Anweisungen der chinesischen Luftwaffe nicht befolgen. Japans Ministerpräsident Shinzo Abe sieht eine «äusserst gefährliche Angelegenheit».
Ähnlich warnt US-Verteidigungsminister Chuck Hagel: «Dieses einseitige Vorgehen erhöht das Risiko von Missverständnissen und Fehlkalkulationen.» Die USA rufen China zur Zurückhaltung auf.
Warnung vor Eskalation
«Es braucht Zeit, um zu sehen, wie die neuen Regeln umgesetzt werden», sagt der Experte Gary Li von der Fachzeitschrift Jane's Defense Weekly der Nachrichtenagentur dpa in Peking. «China könnte Kampfflugzeuge schicken, wenn japanische Flugzeuge entdeckt werden - oder es könnte Aufklärungsflugzeuge der Marine entsenden und dort nur eine »Präsenz« zeigen.»
Er warnt aber vor einer Eskalation, wenn sich Militärflugzeuge in den jetzt überlappenden Zonen begegnen. Denn Japan betreibt schon lange seine eigene Identifikationszone. Erst im Mai 2010 Jahres wurde sie noch deutlich ausgeweitet.
«Sie reicht an einer Stelle nur 130 Kilometer an Chinas Küste», schildert der Experte. Ein grosser Teil überdecke sogar Chinas Wirtschaftszone (EEZ).



Peking erhebt seit Jahren Anspruch auf die von Tokio kontrollierte Inselgruppe im Ostchinesischen Meer. /
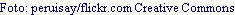

Die Schaffung der eigenen chinesischen Luftverteidigungszone sei eine «direkte Antwort» darauf.
Chinas neue Zone reiche ähnlich an einer Stelle bis 130 Kilometer an Japans Küste - aus chinesischer Sicht eine «proportionale Reaktion».
Antwort auf Abes Politik
Nicht zufällig erfolgt der Schritt wenige Wochen bevor Abes rechtskonservative Regierung neue Richtlinien für das Nationale Verteidigungsprogramm beschliessen will. Ein Kernpunkt ist die Verteidigung abgelegener Inseln.
Laut Medienberichten ist geplant, die Zahl von Tankflugzeugen, die in der Luft betanken können, auf acht zu verdoppeln. So könnten Kampfjets länger in der Luft bleiben. Die Flotte soll um kleinere und schnellere Zerstörer ergänzt werden.
Schon heute lässt Japan täglich Überwachungsflugzeuge der Marine um die japanisch verwalteten Inseln patrouillieren. Wenn ein chinesisches Flugzeug gesichtet wird, steigen F-15-Jäger auf und fordern den Eindringling auf, das Gebiet zu verlassen.
Tokio ist nun besorgt, dass chinesische Flugzeuge solche Warnungen ignorieren oder sogar versuchen könnten, Japans Flugzeuge abzudrängen. Vorerst will Japan weitermachen wie bisher. «Wir müssen sehen, was die andere Seite macht», wurde ein hoher Beamter in Tokio zitiert.
«Symbolische Rache»
«Die neue Zone ist die symbolische Rache für den Kauf mehrerer Inseln durch Japans Regierung im vergangenen Jahr», sagt Professor Kerry Brown vom China-Zentrum der Universität Sydney der Nachrichtenagentur dpa.
Die Regierung in Tokio hatte damals argumentiert, keine andere Wahl gehabt zu haben, weil Nationalisten die Inseln kaufen wollte. «Für China war das aber eine Provokation, die immer noch wehtut.»
Einen kriegerischen Konflikt zwischen den Streithähnen erwartet der Professor vorerst nicht. «Diese gegenseitige symbolische Schikane ist kontrollierbar», glaubt Brown. «Es dürfte aber ziemlich ungemütlich werden, wenn es tatsächlich zu einem physischen Kontakt oder Konflikt käme», sagt der renommierte Experte.
«Nur sind beide Seiten wirtschaftlich so eng verbunden, das dies einer Art »gesicherter gegenseitiger Vernichtung« gleichkäme.» Beide Seiten hätten somit keine andere Wahl, als miteinander auszukommen, findet Brown.