|
Montag, 25. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Vorsicht Lawine!Der winterliche Berg ist kein Kinderspielplatz. Wer sich abseits der Pisten bewegt, tut dies nicht nur auf eigenes Risiko sondern riskiert auch, andere mit ins Verderben zu reissen. Abseits der gesicherten Pisten kann aus Spass schnell tödlicher Ernst werden.asu / Quelle: winterguide.ch / Mittwoch, 15. Januar 2014 / 15:22 h
Jährlich sterben rund 25 Personen durch Lawinen; 90 Prozent der Verschütteten haben ihre Lawine selbst ausgelöst. Wer sich mit Lawinen-Prävention nicht auskennt, sollte im gesicherten Gelände bleiben und seinen Mut in einem
Snowpark kühlen. Der verschneite Berg ist nichts für Draufgänger sondern eher etwas für Sicherheitsfanatiker.
Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos bemüht sich seit Jahrzehnten um Aufklärung und bietet mit dem Lawinenbulletin ein umfassendes Bild über die Lawinensituation in den Alpen. Die Merkblätter, Verhaltensregeln
und Präventionstipps des SLF Davos sollten für jeden Freerider oder Tourengänger heiliger sein als die Bibel - schliesslich rettet das richtige Verhalten nicht nur das eigene Leben sondern auch das von anderen.
Risiko beurteilen Wann und wo die Lawinengefahr am höchsten ist: Prinzipiell lässt sich sagen, dass abseits der Pisten überall Lawinengefahr lauert, wenn diese nicht ausdrücklich heruntergestuft wurde. Besonders bei Neuschnee, Nassschnee, Altschnee, Steil- und an Schattenhängen, bei Triebschneeansammlungen, die durch Winde gebildet wurden, Neuschnee, plötzlicher Temperaturanstieg, Expositionen, Höhelage oder durch unterirdische Schmelzwasserkanäle brüchige Schneedecken: Wer sich nicht genauestens mit dem winterlichen Berg und seiner Topographie auskennt, begibt sich abseits der Piste in tödliche Gefahr.Risiko vermeiden Die oberste Regel lautet beim Beurteilen einer Lawinensituation: Im Zweifelsfall NIE. Denn ein Fehler lässt sich nicht wieder korrigieren, eine Lawine ist nicht aufzuhalten. So gilt es in jedem Fall, jedes Risiko zu minimieren. Nebst der passenden Ausrüstung, wozu auch Lawinensonden und Lawinenschaufeln gehören, ist das wichtigste das aktuelle Lawinenbulletin des SLF Davos. Ständig sollten lawinenrelavente Beobachtungen im Gelände gemacht werden, um die Situationen neu beurteilen zu können. Dazu gehören Witterung, Steillage, Schneemenge bzw. -beschaffenheit und Hangeigenschaften.Typische Lawinenprobleme Neuschnee: Profis wissen: Der erste schöne Tag nach einem Schneefall ist der gefährlichste. Es gilt mindestens 1 bis 3 Tage abzuwarten und zu checken wie die alte Schneedecke mit dem neuen Schnee umgeht. Wenn der Neuschnee auf eine Schwachschicht trifft, kann eine Schneetafel abgleiten. Oder der Neuschnee hält nicht auf der alten Schicht, was zu den gefürchteten trockenen Schneebrettlawinen führen kann. In der Höhe gilt es rauszufinden, ob eine kritische Neuschneemenge gefallen ist, die eine grossflächige Gefahr darstellen kann. Der Neuschnee ist mit Abstand die tödlichste Falle, in die schneehungrige Wintersportler tappen - aus purem Spass, seine Bahnen im jungfräulichen Weiss zu ziehen. Auch dann, wenn es bereits Spuren hat, heisst das nicht, dass die Lawinengefahr gebannt ist. Im Gegenteil. Triebschnee: Der Wind ist Baumeister von Triebschneeansammlungen. Frischer Triebschnee kann ebenso abgleiten, wie abbrechen. Man sollte also auf Rissstellen achten und wie die Einsinktiefen im Schnee sind. Stichwort Skistocktest: Mit dem Skistock lässt sich ablesen und messen, wie ideal die Schneebeschaffenheit und -decke ist. Ist sie weich, hart, nass oder alles zusammen? Besonders in Kamm- und Hochlagen, aber auch bei Geländebrüchen, Felsen, Mulden, etc. gilt es auf Triebschnee zu achten und diese grossflächlich zu umgehen. Nassschnee: Nasser Schnee ist kein gutes Zeichen, um sich abseits der Piste zu bewegen. Der grob kristallene Schnee ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass entweder Sonneneinstrahlung, fehlende Abstrahlung oder wärmende Felsen die Temperaturen ansteigen lassen konnten. Spontanlawinen sind die Folgen. Bevor es dazu kommt, sollte man die Tour frühzeitig beenden. Wenn es nicht anders geht, muss man die Abkühlung abwarten oder versuchen die Gefahr, grossräumig zu umgehen. Altschnee (defensiv, Tage, Wochen): Bei der Lawinenprävention muss man sich an Fakten halten und sich nicht täuschen lassen. Eigentlich würde man ja denken, dass Altschnee, besonders an schneearmen Stellen keine Gefahr darstellen würde. Diese Fehleinschätzung könnte einem aber das Leben kosten. Besonders bei Geländeübergänge, von steil zu flach oder felsdurchsetztes Gelände, häufig Nordhänge; hier kann es zu Lawinen kommen. Darum, ständig die Schneedecke prüfen, weil diese Lawinengefahr besonders schwierig zu erkennen und einzuschätzen ist.Lawinengefahr bei Neuschnee am höchsten Generell zu vermeiden gelten Skitouren und Freerides bei frischem Neuschnee. Frühestens nach einem Tag kann die Neuschnee-Situation beurteilt werden - sobald klar ist, wo wieviel Schnee liegt und wo es Verwehungen hat, die Schneebretter auslösen könnten. Höchste Lawinengefahr gilt ebenso bei schnellem Temperaturanstieg sowie Regen.Kleine Gruppen, gute Führer Es ist aber nicht nur die Natur, die es richtig einzuschätzen gilt, sondern auch die Gruppe, die am Berg unterwegs ist.Wer sich nicht genauestens mit dem winterlichen Berg und seiner Topographie auskennt, begibt sich abseits der Piste in tödliche Gefahr. /
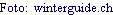 Nebst der Routenwahl ist die Belastbarkeit der Schneedecke ausschlaggebend. Kleinere Gruppen reduzieren das Risiko einer zu hohen Belastung, besonders an Steilhängen. Die Gruppe sollte nur einem erfahrenen Führer folgen, der die verschiedenen Touren-Varianten eines Berges kennt und um die heiklen Stellen weiss, in denen Felsen Schneefelder aufheizen können oder Triebschneeansammlungen ein Risiko sein könnten. Ein erfahrener Tourenguide wird seine kleine Gruppe möglichst nur über Gebirgsrücken führen und nie unterhalb eines grossen Hanges durchgehen. Ausserdem wird er beim Aufstieg den Sicherheitsabstand von mindestens 10 Meter zum Vordermann einhalten, bei der Abfahrt noch mehr. Es gilt Stürze zu vermeiden und möglichst sanft durchs Gelände zu gleiten, das heisst nicht möglichst schöne Spuren, sondern so geringe Belastung wie möglich. Trockenlawine Die gefährlichste Lawine für Touren- und Variantenfahrer ist die trockene Schneebrettlawine. Sie sind sogar bei unschuldig funkelndem Pulverschnee möglich, wenn die Schneedecke darunter lawinengefährdet ist. Lockerschneelawinen sind dagegen weniger dramatisch, weil sie langsamer sind und häufig in Gelände vorkommen die steiler sind als 40° Grad.Nicht täuschen lassen Auch wenn ein Schneehang oberflächlich ungefährlich und einladend aussieht, kann sich darunter eine Katastrophe ankündigen. Dann zum Beispiel, wenn Schmelzwasser unter die trockene Schneedecke läuft. Gefährlich ist natürlich auch Regen oder plötzlicher Temperaturanstieg. Kälte ist jedoch nicht nur ein gutes Zeichen. Denn Kälte konserviert im Hochwinter die Gefahr - es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Temperaturen ansteigen und Lawine ihren Lauf nimmt.Die 10 Gebote Wer als Freerider, als Variantenskifahrer oder Tourenfahrer unterwegs ist, muss stets das Risiko einschätzen können. 1. Orientierung über Wetter und Lawinensituation bei SLF Davos, Tel. 081 417 01 11. 2. Laufende Neubeurteilung von Verhältnissen, Gelände und Mensch. 3. LVS auf Senden, Schaufel und Sonde dabei. 4. Frische Triebschneeansammlungen umgehen. 5. Schlüsselstellen und extreme Steilhänge einzeln befahren. 6. Nie bei schlechter Sicht in unbekannte Gebiete. 7. Tageszeitliche Erwärmung beachten. 8. Sicherheitsabstand einhalten, auch beim Aufstieg mindestens 10 Meter. 9. Auf Fakten verlassen und Wahrnehmungsfallen vermeiden. 10. Kein Risiko eingehen. Nie!Merksätze Der 1. schöne Tag nach einem bedeutenden Schneefall ist besonders gefährlich. Neuschnee + Wind = Lawinengefahr. Je steiler und schattiger desto gefährlicher. Frische Lawinen und «Wumm»-Geräusche sind Zeichen für Lawinengefahr. Schnelle und markante Erwärmung führt kurzfristig zu einem Anstieg der Lawinengefahr. Damit Schneebrettlawinen entstehen können braucht es schwache Schichten in der Schneedecke. Nimm Dir auf Erden lieber Zeitund jag' nicht durchs Getümmel. Bedenke, Freund, es ist nicht weit, per Freeride in den Himmel!
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|