|
Donnerstag, 7. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Magersucht: Externe Faktoren sowie Gene schuldNew York - Das Columbia University Medical Center hat in einem neuen Mausmodell nachgewiesen, wie eine Kombination von genetischen und umweltbedingten Risikofaktoren Magersucht auslöst.bg / Quelle: pte / Freitag, 15. April 2016 / 09:15 h
Anorexia nervosa ist laut dem Team um Lori Zeltser die dritthäufigste chronische Erkrankung bei jungen Menschen in den USA. Die Sterblichkeit liegt bei acht bis 15 Prozent, die höchste bei allen psychiatrischen Erkrankungen.
Stress und Gene im Blick Forscher nehmen an, dass sich das Risiko einer Erkrankung durch eine Kombination von genetischen, biologischen, psychologischen und soziokulturellen Faktoren erhöht. Eine Hürde bei der Entwicklung neuer Therapien war jedoch das Fehlen von Tiermodellen, die das Entstehen der Krankheit nachvollziehbar machen. Laut Zeltser haben bisherige Tiermodelle Faktoren wie sozialen Stress und genetische Komponenten von Angstgefühlen und Magersucht nicht berücksichtigt, die aber wahrscheinlich zum Entstehen einer Erkrankung beitragen. Daher setzten die Experten heranwachsende Mäuse zumindest einer Kopie des Gens BDNF aus. Dieses wurde bereits mit Magersucht und Angst bei Mäusen und Menschen in Verbindung gebracht. In einem nächsten Schritt wurden die Tiere einer kalorienarmen Ernährung unterzogen, die laut dem Team beim Menschen einer Magersucht vorausgeht. Die Kalorienzufuhr wurde dabei um 20 bis 30 Prozent verringert. Laut Zelster ist einer der Einflussfaktoren beim Menschen der Gruppenzwang, vor allem der Wunsch, dünn zu sein. Die Wissenschaftlerin geht davon aus, dass sich dieser Faktor bei Mäusen nicht herstellen lässt. Daher wurde er aus der Gleichung genommen.Gene und Umwelt beeinflussen die Magersucht. /
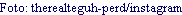 Die Forscher konzentrierten sich stattdessen auf sozialen Stress. Dieser kann schon dadurch hervorgerufen werden, dass die Tiere allein und nicht in Gruppen untergebracht werden. Wurden die Mäuse mit der BNDF-Genvariante sozialem Stress durch Isolation und einer eingeschränkten Ernährung unterzogen, mieden sie Futter eher als die Tiere der Kontrollgruppe. Komplexes Zusammenspiel Wurden diese Faktoren auf erwachsene Mäuse angewendet, kam es zu keiner derartigen Veränderung. Wurden die heranwachsenden Tiere mit der Genmutation nur einem Faktor ausgesetzt, veränderte sich ihr Fressverhalten kaum. Laut Zester ist damit klar, dass ein genetisches Risiko allein nicht ausreicht, um ein Verhalten wie bei einer Magersucht auszulösen. Es überträgt sich jedoch vor allem in der Jugend auf die Anfälligkeit für sozialen Stress und Diäten. «Alle diese Variablen müssen zusammenspielen, damit es zu grundlegenden Auswirkungen auf das Essverhalten kommt», so Zelster. Da die Studie mit Mäusen und nicht mit Menschen durchgeführt wurde, räumen die Forscher ein, dass es immer Fragen geben wird, inwieweit ein Tiermodell eine so komplexe Erkrankung wie Magersucht abbilden kann. Viele entscheidende Komponenten gäben jedoch jene Faktoren wieder, die zum Entstehen einer Essstörung beitragen. Derzeit würde das neue Mausmodell nur zur Erforschung von Signalwegen im Gehirn genutzt, die zu einem magersüchtigen Verhalten beitragen können. Sie hoffen, bald neue Therapien gegen Magersucht zu finden. Die Ergebnisse wurden in «Translational Psychiatry» veröffentlicht.
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|