|
Mittwoch, 20. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Kommentar: Hehlerei Einerlei?Das Problem ist knifflig und die Bruchlinie geht quer durch die deutschen Regierungsparteien: Soll eine geklaute Daten-CD mit Bankdaten eingekauft werden oder nicht? Und damit 2.5 Millionen Euro auf das Konto eines Datendiebes überwiesen werden?von Patrik Etschmayer / Quelle: news.ch / Montag, 1. Februar 2010 / 15:05 h
Als Belohnung winken dem deutschen Staat womöglich über 100 Millionen Einnahmen aus hinterzogenen Steuern. In dieser Zeit, in der Deutschland (und nicht nur Deutschland) jeden Cent und Rappen zweimal umkehren muss, bevor er ausgegeben wird, ist das sicher verlockend, zwar nur ein Tropfen auf den heissen Stein, aber man ist um jedes Tröpfchen froh.
Doch was ist das Risiko? Es geht hier um Gesetzesdifferenzen zwischen zwei Staaten. Die Steuerproblematik beherrscht schon seit Jahren die Schlagzeilen und ist bei jedem Treffen von Politikern der beiden Länder zuoberst auf der Traktandenliste. Ein bilaterales Problem also, dass auf dem Verhandlungsweg gelöst werden muss. Doch Verhandlungen sind langwierig und erfordern Eingeständnisse – Kompromisse, die man lieber nicht eingehen würde. Doch das ist eben so, in der Politik zwischen Ländern, welche ihre Rechtsordnungen gegenseitig anerkennen.
Ist Datenhehlerei des Rechtens?
Und nun diese CD… ein Apfel der Versuchung sowohl für die deutsche Kanzlerin als auch ihren Finanzminister . Doch der Kauf wäre ein Präzedenzfall, den man zu setzen sich gut überlegen sollte. Denn es gibt bei weitem nicht nur Kontendaten, die attraktiv sind für gewisse Regierungen.
Man stelle sich vor, ein deutscher Hacker schafft es, die Mail-Accounts von chinesischen Dissidenten zu knacken und die Daten dieser Accounts zu klauen. Diese Leute sind zwar nicht in den Augen der deutschen Regierung, wohl aber in denen der betreffenden Länder Verbrecher.
Darf Deutschland gestohlene Daten kaufen? /
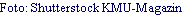 Der Hacker bietet dem Regime in Peking die Daten für 5 Millionen Euro an, ein Deal, der durch eine Indiskretion publik wird. Darf die Deutsche Bundesregierung nun eingreifen? Deutschland und China verbinden enge wirtschaftliche und politische Bande. Menschenrechtsfragen werden immer nur scheu am Rande angesprochen, wenn die Politiker auf Staatsbesuch sind. Und nun wäre da ein Datendieb, der sein Diebesgut verhökert – mit womöglich drastischen Konsequenzen für die betroffenen Menschen. Aber was wäre das Argument der deutschen Regierung? Schliesslich hätte sie selbst gezeigt, dass Datenhehlerei des Rechtens ist, wenn es mit der eigenen Staatsraison vereinbar ist. Neue Geldquelle für das organisierte Verbrechen Natürlich – das Beispiel ist extrem und von den Konsequenzen für die Betroffenen nicht symmetrisch: Steuernachzahlungen oder chinesisches Arbeitslager sind zwei Paar Schuhe. Doch das Prinzip ist dasselbe. Es gibt noch einen weiteren Grund, Abstand davon zu nehmen, gestohlene Daten zu kaufen. Es wird so nämlich klar, dass mit geringem Aufwand grosse Geldbeträge auf zwielichtige Weise zu generieren sind. Diese Art der Mittelbeschaffung ist auch für das organisierte Verbrechen attraktiv. Datensätze, die durch Erpressung, Hacken und andere illegale Methoden erworben werden, könnten so zu einer Geldquelle werden, um andere Verbrechen zu finanzieren. Sich für die Drecksarbeit auf Diebe zu verlassen ist zudem schäbig. Wenn der deutsche (oder französische, italienische… welcher auch immer) Staat scharf auf Bankdaten ist, dann sollen es diese doch auf die alte, bewährte Art machen: Spione in die Banken einschleusen und die Daten in eigener Regie klauen. Das ist zwar mühsam und man muss nachher erklären, warum Spione in ein befreundetes Land geschickt werden. Aber es ist ehrlicher und weniger heuchlerisch, als Diebesgut von habgierigen Gesetzesbrechern einzukaufen, unter dem Vorwand, damit dem Recht zu dienen.
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|