|
Freitag, 8. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Qualitätsverlust der Medien belastet die DemokratieBern - Die Schweizer Demokratie leidet unter der schlechten Qualität der Medien: So lautet der Befund des Jahrbuchs 2010 «Qualität der Medien». Schuld an der Medienkrise seien vor allem die Gratiskultur im Internet und bei Pendlerzeitungen sowie der Spardruck auf den Redaktionen.fkl / Quelle: sda / Freitag, 13. August 2010 / 14:38 h
Anstatt ausgewogen über politische Debatten zu berichten, beherrschten Formfragen die Mediendiskurse, schreiben die Wissenschaftler der Universität Zürich in der am Freitag in Bern veröffentlichten Studie. Die Informationsmedien vernachlässigten ihre Funktion, die Bürgerinnen und Bürger über das politische Geschehen aufzuklären.
Ein gutes Beispiel sei die Minarettinitiative vom vergangenen Herbst: Obwohl die Mehrheit der Schweizer Parteien gegen das Minarettverbot waren, beherrschten die Befürworter die mediale Debatte. «PR-Aktionen wie das Minarettplakat erreichten intensive mediale Berichterstattung», heisst es im erschienen Jahrbuch.
Negative Entwicklung geht weiter
Co-Autor Mark Eisenegger bemängelte in diesem Zusammenhang auch, dass in den letzten Monaten wenige Topthemen aus dem Softbereich wie der Hausarrest von Regisseur Roman Polanski oder das Privatleben des Zürcher Clubbesitzers Carl Hirschmann die Medien beherrschten. «Auf der anderen Seite geraten internationale Probleme immer mehr aus dem Blickfeld», sagte Eisenegger.
Ein Ende der negativen Entwicklung ist gemäss den Forschern des Bereichs Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich nicht in Sicht. Die publizistische Versorgung durch qualitätsschwache Medien im Internet und der gedruckten Presse werde weiter zunehmen.
Die Informationsmedien vernachlässigten ihre Funktion, die Bürgerinnen und Bürger über das politische Geschehen aufzuklären. (Symbolbild: Newsroom) /
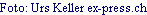 Denn vor allem jüngere Mediennutzer zwischen 15 und 34 Jahren seien mit der «Gratiskultur» gross geworden. Wirtschaftsmedien: Krise viel zu spät erkannt Die Kritik richtet sich auch an die Wirtschaftsjournalisten. Den Autoren zufolge haben sie die Finanzmarktkrise viel zu spät erkannt. «Ihre seismographische Funktion hat versagt», so Eisenegger. Zudem sei die globale Wirtschaftskrise auf eine UBS-Krise reduziert worden, was einen grossen Teil des Themas ausblende. Finanziert und gefördert wird das Jahrbuch «Qualität der Medien» durch die gemeinnützige Stiftung «Öffentlichkeit und Gesellschaft». Zum Stiftungsrat gehören unter anderem der Soziologe Kurt Imhof, die Aargauer Ständerätin Christine Egerszegi oder der ehemalige Bundesratsspecher Oswald Sigg. Das über 370 Seiten starke Buch ist das erste seiner Art - künftig soll jährlich eins erscheinen. Damit wollen die Soziologen und Medienwissenschafter «das Qualitätsbewusstsein für die Medien stärken», wie es Kurt Imhof ausdrückte.
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|