|
Donnerstag, 7. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Atomdesaster deckt Verflechtungen aufZürich - Japan erlebt in Folge der derzeitigen Natur- und Nuklearkatastrophen seine grösste Krise der Nachkriegszeit. Sozialwissenschaftler glauben, dass der Inselstaat künftig vereinter auftreten und dabei neue Kräfte entwickeln wird.ht / Quelle: pte / Samstag, 26. März 2011 / 16:53 h
Dass dabei eine totale Umgestaltung bevorsteht, sieht der Zürcher Japanologe David Chiavacci.
«Zu erwarten ist, dass speziell die Zivilgesellschaft Japans gestärkt aus der Krise hervorgehen wird», so der Experte.
Zivilgesellschaft bisher mundtot Die Zivilgesellschaft - allen voran die NGOs und NPOs - nahmen in der Nachkriegsgeschichte Japans eine völlig andere Entwicklung als in den westlichen Industrieländern. «Zunächst sehr aktiv beteiligt, verlor Japans Zivilgesellschaft im Zuge der Wachstumspolitik seit den 60er-Jahren jeglichen Einfluss auf nationaler Ebene. Im japanischen Beschäftigungsmodell akzeptierten die Arbeitnehmer die Entscheidungshoheit des Managements und dessen Ausrichtung an Profitstreben und Produktivität, während die Arbeitgeber langfristige Beschäftigung und betriebsinterne Karriere ermöglichten.»Mitsprache verwehrt Bewegung im erstarrten System gab es erst mit der wirtschaftlichen Stagnation seit 1992, besonders jedoch in Folge des Kobe-Bebens 1995, bei dem der Staat mit seiner Katastrophenhilfe völlig versagte. Zivile Organisationen erhielten Aufwind und hohe Auflagen für ihre nationale Anerkennung wurden gelockert, wenngleich Chiavacci auch hier Interessen des Staates wie etwa die Kostenersparnis durch das Auslagern sozialer Dienste sieht. Bei wichtigen politischen Entscheidungen - darunter auch die Energiepolitik - blieb die Mitsprache jedoch verwehrt. Das wird sich jetzt ändern, so die These des Japanforschers.Staat und Wirtschaft verflochten Die Atompolitik war bisher von enger Verflechtung zwischen Staat und Wirtschaft geprägt, deren Hinterfragung auf Nationalebene stets verhindert wurde. «Trotz der Atombombe in Hiroshima und breiter Widerstände ging Japan den nuklearen Weg.Erstmals werden die Verfilzungen zwischen Wirtschaft und Politik kritisiert. /
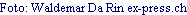 Man stellte Atomstrom als Grundstandbein des Wachstumsprojekts dar, das mehr Unabhängigkeit von Gas- und Ölimporten bringen sollte.» Hätte auch die Nuklearenergie in Japan nie einen Volksentscheid gewinnen können, sah man sie doch als Teil des übergeordnetes Ziels, dem man sich trotz persönlicher Ablehnung fügte. Zudem vertraute Japan der Technik stets ausserordentlich hoch. Jetzt sieht Chiavacci in Japan allerdings einen «Tschernobyl-Effekt» im Gange. «Bisher umging die Regierung regionale Widerstände, indem sie finanziell maroden Gemeinden mit Ertragshoffnungen für die AKW-Standorte köderte. Nun steht das Land aufgrund der Fukushima-Sperrzone und der radioaktiven Belastung unter atomarem Schock, allen voran einflussreiche Akteure wie etwa die Bauerngenossenschaften.» Erstmals kritisieren nun auch die Medien öffentlich die engen Netzwerke wie etwa jene zwischen Staat und der AKW-Betreiberfirma TEPCO und auch künftig stehe noch einiges an Aufarbeitung bevor. Neue Generation von Politikern Schon heute deute einiges auf einen Wandel der Gesellschaft. Japanische NGOs leisten derzeit den Grossteil der Überwindung der Tsunami- und Erdbebenkatastrophe. «Sie koordinieren die Hilfsaktionen, bei denen ganz Japan Decken spendet und viele ehrenamtlich anpacken oder bei der Verteilung der Hilfsgüter mitwirken. Sind wir auch noch in der Frühphase nach der Katastrophe, so ist die Zivilgesellschaft derzeit präsent wie nie.» Auch die Person des gegenwärtigen Premiers Naoto Kann wertet Chiavacci als richtungsweisend. Anders als der Grossteil seiner Politikerkollegen, gelang der frühere NGO-Aktivist an die Macht, ohne dafür den Wahlkreises und das Unterstützungskomitee seines Vaters zu übernehmen.
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|