|
Freitag, 8. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Der eingeigelte EuropäerNachdem die «wahren Finnen» einen Erdrutschsieg bei den Finnischen Parlamentswahlen errungen haben, ist mal wieder klar, dass der Patriotismus und/oder Nationalismus in Europa im Vormarsch ist. Denn auch in Österreich dürften bei den nächsten Wahlen die Rechtsausleger der FPÖ gewinnen, während sich in Frankreich der «Front National» daran macht, den Élisée-Palast zu stürmen.Patrik Etschmayer / Quelle: news.ch / Montag, 18. April 2011 / 13:03 h
Auch in Holland und Italien haben Nationalisten ein immer stärkeres Wort in der Politik mit zu reden. In Osteuropa wie in Ungarn oder im einstigen Jugoslawien bestimmen die Nationalisten die Politik. Nur Deutschland ist momentan noch eine Ausnahme (die NPD kriegt keinen Fuss auf den Boden, aber es gibt immer mehr gewalttätige Nazis), während «unsere» SVP durchaus als Patriotismus-Pionier in Europa gelten darf.
Die Frage, die man sich unwillkürlich stellt ist: warum? Warum ist ein politisches Dogma, dass vor 25 Jahren noch ein Nischendasein fristete plötzlich wieder ein Top-Hit unter den Stimmbürgern unseres Kontinents? Liegt es wirklich nur an der EU, wie es die Top-Themen bei den Wahlkämpfen der Nationalistischen Parteien allenthalben nahelegen?
Doch weshalb segelt auch in den USA die Tea-Party auf dem Patriotismus-Wind, etablieren sich Nationalisten in Russland?
Eine Gemeinsamkeit all dieser Bewegungen in Europa ist wohl die Ansicht, dass alles übel von aussen kommt oder der heimische Abwehrreflex gegen das, was jenseits der Grenzen ist, nicht als stark genug betrachtet wird. Wer nicht patriotisch ist, ist nach dieser Logik deshalb entweder a) Ausländer oder b) ein Verräter.
Diese dialektische, schwarz-weisse Betrachtungsweise der Welt bekommt speziell während Krisen und Zeiten des Umbruchs Aufwind. Der Startschuss für das Nationalismus-Revival dürfte denn auch um die Zeit des Zusammenbruch des Sowjetreichs und mit dem Ende des kalten Krieges gefallen sein.
Zuvor war auf beiden Seiten des eisernen Vorhangs so ziemlich jedem klar, dass ein einzelner Staat drohte, zwischen den Machtblöcken zermalmt zu werden. Dies zeigte sich auch immer wieder an den heissen Fronten, wo die Blöcke aufeinander prallten und Stellvertreterkriege austrugen: Korea, Vietnam, Mittelamerika, Afghanistan waren der plätschernde Backgroundhorror von Jahrzehnten.
So waren die EWG und danach die EU nicht nur das Friedensprojekt der Europäer, die zuvor relativ schlechte Erfahrungen mit extremem Patriotismus gemacht hatten, sondern auch der Versuch ein eigenes Gewicht, eine eigene Bedeutung in der Welt zu bekommen. Nationalismus erschien da ganz klar wie ein Relikt aus grauer Vorzeit. Und alles stand im Schatten des kalten Krieges
Dann war dieser plötzlich vorbei und ja, wir müssen froh darüber sein. Doch die Illusion der Freiheit, welche in den euphorischen frühen 90ern folgte wurde bald durch neue Ängste abgelöst. Das globalpolitische Tauwetter liess auch lange eingefrorene Konflikte wieder in Fluss geraten: Der mit patriotischer Inbrunst geführter Bürgerkrieg mit den auf verschiedenen Seiten begangenen Massakern, erinnerte zum Teil an die schlimmeren Episoden des zweiten Weltkrieges, genau so wie die Entmenschlichung der anderen Volksgruppen.
Timo Soini: Wahrer finnischer Einigler /
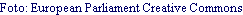 Während Jugoslawien regelrecht explodierte, rückten die Politiker von Europa immer näher zusammen, während viele Bürger nach einer neuen Identität suchten. Doch das brüsseler Europa bot und bietet dieses Heimatgefühl nicht, viel mehr erscheint es wie eine surreale Politmaschine, die Dinge ohne Legitimation der Bürger beschliesst, es Grosskonzernen und -banken erlaubt, ihre Schulden auf die Steuerzahler abzuladen und - was momentan vor allem die Gemüter erregt, die schlechte Haushaltsdisziplin einzelner Staaten per Rettungsschirm auf alle zu verteilen. Doch das entscheidende ist, dass patriotische Parteien ein scheinbar konkretes Gefühl der Zugehörigkeit bieten. In Zeiten der Unsicherheit wird so gefühlte Sicherheit erzeugt, das vermeintliche Wissen darum, wer für einen ist, wo man Zuflucht finden kann. Patriotismus in Russland oder den USA dient auch heute noch zum Zusammenhalt der grossen Nationen, ist ein fester Bestandteil des Alltags und hat in der Aussenpolitik mitunter irritierende Effekte zur Folge, aber verändert in diesen Nationen selbst nicht allzu viel. Der neue Patriotismus in Europa hingegen könnte den Kontinent um Jahrzehnte zurück werfen und alte Feindschaften wieder beleben. Umstrittene Minderheitengesetze in Ungarn und ähnliche Ansinnen in Finnland deuten schon darauf hin. Dies vor allem, weil sich Europa als Idee nicht in den Köpfen und schon gar nicht in den Herzen hat durchsetzen können - nicht zuletzt dank der EU. Die ganzen Fehler und Schnellschüsse, das zu schnelle Wachstum der Union, die zweifelhaft legitimierte Verfassung, haben diese Chance für dauerhaften Frieden auf unserem Kontinent nachhaltig geschwächt. Die Wirtschaftskrise hat diesem Projekt womöglich den Rest gegeben. Statt sich in Europa zu Hause zu fühlen, igeln sich die Europäer nun wieder in ihrer Nation ein. Wenn es nicht bald gelingt, Europa mit einer neuen, gemeinsamen Vision zu beseelen, könnte die EU bald Vergangenheit sein. Momentan ist von einer solchen Vision leider kaum etwas zu sehen. Es sieht schlecht aus für das Friedensprojekt.
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|