|
Donnerstag, 28. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Kapitalisten im «Frühstadium des Sozialismus»Über eine Million Millionäre gibt es in China und nach neuesten Zahlen etwa 300 Milliardäre. Nicht etwa in der Volkswährung Yuan Renminbi sondern umgerechnet in harte Schweizer Fränkli.et / Quelle: news.ch / Dienstag, 22. Mai 2012 / 10:15 h
Es sind Privatunternehmer, die es in der «sozialistischen Marktwirtschaft chinesischer Prägung» mit Sinn fürs Geschäft, Innovation und Risiko ganz nach oben geschafft haben. Mit andern Worten, es sind die Reichsten der Reichen im Reich der Mitte. Dazu kommt ein aufstrebender Mittelstand, der vor allem im industrialisierten, wohlhabenden Küstengürtel schnell wächst. Derzeit gibt es rund 200 Millionen Mittelständler, wenn man als Messlatte eine gute Ausbildung und ein jährliches Einkommen per capita von umgerechnet zehn- bis dreissigtausend Franken ansetzt.
In strategisch wichtigen Industrien wie Erdöl, Gas, Elektrizität, Atom, Banken oder Telecom hat, wenn auch in knallhartem Wettbewerb, noch immer der Staat das Sagen. Der Rückgang freilich ist eklatant. Gab es 1998 noch 65'000 Staatsbetriebe, waren es 2010 gerade noch 20'000. Der Ausstoss ging von 50 Prozent an der chinesischen Gesamtproduktion auf 27 Prozent zurück. Die Privatwirtschaft trägt nach 33 Reformjahren unterdessen Entscheidendes zur Volkswirtschaft bei. Allein die 7,5 Millionen Kleinen und Mittleren Betriebe (KMU) generieren knapp fünfzig Prozent des Brutto-Inlandsprodukts und haben über siebzig Prozent aller Arbeitsplätze geschaffen.
Was für ein Unterschied zur noch nicht so weit entfernten chinesischen Vergangenheit. Der Grosse Steuermann Mao Dsedong predigte einst den Klassenkampf und verurteilte während der Grossen Proletarischen Kulturrevolution (1966-76) Staatschef Liu Shaoqi und den Partei-Granden Deng Xiaoping als Kapitalist Nummer 1 und Nummer 2. Liu - strammer Kommunist und enger Weggefährte von Mao - bezahlte die politische Kampagne mit dem Leben. Deng wurde, obwohl zuvor ein treuer Gefolgsmann Maos, als gewöhnlicher Arbeiter in eine südliche Provinz verbannt.
Maos chinesisches Modell brachte zwar nationale Unabhängigkeit und Stolz, doch keinen Wohlstand. Erst als Deng Xiaoping nach Maos Tod ab 1979 kollektive Landwirschaft und Planwirtschaft aufgab, verbesserte sich das Los der Chinesinnen und Chinesen. Die Wirtschaft stand und steht im Mittelpunkt und nicht mehr politische Kampagnen. Dieses Wachstums-Modell sucht seinesgleichen in der Weltgeschichte.
Nur dreissig Jahre später wimmelt es im Reich der Mitte von Kapitalisten. Allerdings werden Kapitalisten nicht Kapitalisten genannt, denn schliesslich befindet sich China unter der Ägide der allmächtigen Kommunistischen Partei noch immer im «Frühstadium des Sozialismus». Aber Unternehmer, Millionär oder gar Milliardär, das darf man wohl sein und, seit einigen Jahren, gleichzeitig auch Parteimitglied.
Luxus-Autos in Shanghai: Mit einer Million Millionäre ein guter Markt /
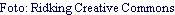 Kein Wunder, dass die Reichsten die Parteikarte ziehen, wenn es darauf ankommt, das Geschäft zu fördern und den Reichtum zu mehren. Networking ist im Dickicht der «sozialistischen Marktwirtschaft chinesischer Prägung» noch wichtiger als anderswo. Guangxi, Beziehungen, haben eine lange Tradition. Deng Xiaopings berühmtes Diktum zu Beginn der Reform, wonach reich sein eine gute Sache sei, ist heute politisch inkorrekt. Die Kluft nämlich zwischen Arm und Reich und Stadt und Land vergrössert sich. Nicht dass die Armen ärmer geworden wären. Im Gegenteil, auch sie haben profitiert. Allein die Reichen habe noch mehr gewonnen. Aber den Reichtum an die grosse Glocke zu hängen, wagen nicht allzuviele, es sei denn, es fliesse Geld für einen guten Zweck. Die Lektüre der Wirtschafts-, Börsen- und Immobilienseiten der Parteiblätter und der ausländischen Websites hat unter Mittelständlern, vor allem aber den Reichen und Reichsten Vorrang vor der Lektüre von Marx, Engels, Lenin, Stalin oder Mao. Die Elite zieht es, wie neueste Untersuchungen zeigen, immer mehr ins vornehmlich westliche Ausland. Einen Pass oder eine Green Card gibt es bei Investitionen ab einer Million amerikanische Dollar rund um die Welt. Beliebteste Destinationen sind - in dieser Reihenfolge - Kanada, Amerika, Singapur, Australien und Europa. Es ist schon fast ein Paradox, dass jene, die am meisten vom kommunistischen Kapitalismus profitiert haben, dem Land den Rücken kehren. Die Gründe sind ziemlich klar: Gesunde Luft, bessere Ausbildung für die Kinder, Rechtssicherheit, kurz Lebensqualität. Das alles kann selbst für Geld in China nicht erstanden werden. Der Exodus der Reichen ist ein Phänomen, das auch in Taiwan oder Hong Kong bei etwa gleichem ökonomischen und politischem Entwicklungsstand in den 1970er Jahren zu beobachten war. Zudem ist auch in hohen und höchsten Parteikreisen ein kürzerer oder längerer Aufenthalt in Übersee nicht selten. Schon Deng Xiaoping schickte einen Sohn zum Studium nach Harvard, und der künftige Staats- und Parteichef Xi Jinping hat eine Tochter, die in Harvard studiert und eine Schwester, die in Kanada lebt. Auch das kürzlich gestürzte Politbüro-Mitglied Bo Xilai hat einen Sohn, der zunächst in Cambridge und jetzt in Harvard seinen Studien nachgeht; zudem soll Bos Frau versucht haben, beträchtliche Summen ins Ausland zu verschieben. Wealth Management im Ausland hat also Vorrang vor dem Kommunistischen Manifest. Schliesslich leben Chinesinnen und Chinesen im globalisierten 21. Jahrhundert und nicht mehr in der Qing-Dynastie (1644-1911). Damals verfügten die kaiserlichen Behörden ein Verbot, sich im Ausland niederzulassen. Unter Androhung der Todesstrafe. Kopf ab.
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|