|
Freitag, 22. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Mediale Apokalypse - die vier journalistischen ReiterDie westlichen Medien schauten gebannt auf Satellitenkarten der amerikanischen Ostküste, und pünktlich trafen sie ein, die Schlagzeilen mit biblischem Vokabular: der «Sintflut» (Blick), den «4 Reitern der Apokalypse» (20 Minuten). Auf der Suche nach Superlativen werden die Journalisten selber zu Reitern, die mit ihren sprachlichen Pferden ungerührt über das Geschehen und über die Opfer hinweg trampeln.Reta Caspar / Quelle: news.ch / Donnerstag, 1. November 2012 / 08:58 h
Jedes erfolgreiche Buch braucht einen prägnanten Anfang und einen fulminanten Schluss, so auch die Bibel. Sie beginnt mit dem Anfang, an dem das «Wort» gestanden haben soll, und sie schliesst mit der Offenbarung des Johannes über das grauenvolle Ende der Welt samt Auftritt der «vier apokalyptischen Reiter»: alles in ziemlich wirren, gruseligen und abstossenden Worten, aber offenbar trotzdem - oder gerade deshalb? - attraktiv für JournalistInnen. Die Redaktionen lassen ihnen das durch, oder setzen damit sogar selber schrille Titel. Das gilt selbst für Traditionsblätter wie die «gute alte» NZZ, die immer mal wieder den Begriff «Sintflut» bemüht, wenn ein Hochwasser irgendwo Schaden verursacht.
Keine Ahnung von den verheerenden Zusammenhängen, in denen dieses Vokabular in der Bibel verwendet wird, für die journalistischen Reiter zählen nur die schnellen Effekte:
1. journalistischer Reiter: der weisse Blender
Wer in einem mehrheitlich säkularen Umfeld religiöse Metaphern verwendet, sucht den hypen Titel und den billigen Medieneffekt und nimmt dabei nur sich selbst und seine Profilierung wahr und weder die Betroffenen noch die Religion ernst. 2. journalistischer Reiter: der rote Skandalierer Wer von Apokalypse spricht, sucht den Schockeffekt auf Kosten der aufklärenden Beschreibung, greift zum religiösen Vierhänder und rechtfertigt zudem den Schaden mit dem göttlichen Plan des Weltuntergangs. 3. Hurricane Sandy: Oberflächliches, zynisches Bibel-Metapher-Dreschen. /
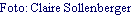 journalistischer Reiter: der schwarze Opportunist Wer achtlos religiöse Metaphern verwendet, gibt vor, gebildet und kulturgeschichtlich bewandert zu sein und bedient sich der Deutungsmacht der kulturellen Tradition. Dabei wirft er die Metapher nur hin und bemüht sich nicht - oder ist unfähig - ihre Bedeutung auszudifferenzieren. 4. journalistischer Reiter: der fahle Zyniker Wer «Sintflut» schreibt, sucht nicht nach wirklichen Kausalitäten und schreibt den Opfern einer Katastrophe letztlich die Schuld zu und rechtfertigt die Vernichtung mit einer göttlich verordneten Strafe für nicht gottgefälliges Benehmen. Mit journalistischen Grundsätzen hat solche Schreibe nichts zu tun: keine Wahrhaftigkeit, keine Informationsvermittlung, keine professionelle Distanz sondern nur scheinbare Einordnung mittels oberflächlichen Umgangs mit Metaphern. Die Kirchen müssten sich eigentlich dagegen verwahren, aber sie tun es nicht. Sie begnügen sich offenbar damit, die Kulisse des medialen Deutungshorizontes zu liefern und nehmen in Kauf, dass das Publikum die Religion und ihre Metaphern nur noch als Worthülsen und allenfalls als Verweis auf die virtuelle Realität von Katastrophenfilmen versteht - nach dem Motto: lieber eine mediale Apokalypse als gar keine?
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|