|
Sonntag, 10. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Auf der Suche nach der Stadt der Zukunft«Zukunftsstädte» - was soll man sich darunter vorstellen? Und wie sehen nachhaltige Städte in der Zukunft aus? Um diese Fragen drehte sich die ETH Sustainability Summer School 2013.Andrea Häberlin / Quelle: ETH-Zukunftsblog / Mittwoch, 21. August 2013 / 15:26 h
Welche Antworten wir gefunden haben, möchte ich anhand unserer Projektentwicklung berichten. Die Aufgabe lautete, in der asiatischen Metropole Singapur Arbeitsplätze und Wohnraum für rund 200'000 Einwohner zu konzipieren.
Seit 2010 bietet ETH Sustainability forschungsfreudigen Studierenden die Möglichkeit, sich im Rahmen der gleichnamigen Summer School in einem internationalen Team über das Thema Nachhaltigkeit auszutauschen. Die Interdisziplinarität der Projekte ermöglicht es Studierenden aus allen Gebieten, am Diskurs teilzunehmen. Ich selbst studiere Publizistik- und Kommunikationswissenschaften. Die diesjährige Sommerakademie handelte vom Städtebau unserer Zukunft. «Also viel Architektur- und Technikwissen!», dachte ich mir und hatte im Vorfeld gewisse Zweifel, ob ich da richtig bin. Schlussendlich ging es aber weder um blosses Fachwissen noch um detaillierte Rechnereien - was zählte war die Teamarbeit und der interkulturelle Austausch. Sommerakademie «Future Cities 2013» Die dreiwöchige Forschungsarbeit fand im Future Cities Lab des ETH Centre for Global Environmental Sustainability (SEC) in Singapur statt. Neben mir als Kommunikationsstudentin nahmen Biologinnen, Architektinnen, Physiker aber auch Philosophen am Projekt teil und diskutierten mit Experten unterschiedlicher Fachrichtungen über Fragen wie diese: Welche möglichen Konzepte gibt es, um unsere Umgebung - die Stadt - für die Einwohner attraktiver zu gestalten? Vorlesungen und die zur Verfügung gestellte Literatur lieferten die Wissensbasis für unsere Diskussionen. Ausganspunkt des Projekts bildete das unbebaute Gebiet «Tampines North», ein 2.5 Millionen m2 grosses Areal im Norden Singapurs. Unsere Aufgabe: Wohnraum für 150'000 Einwohner und Arbeitsplätze für 70'000 Personen zu schaffen. Natürliche Grünflächen erhalten Eine moderne und ökologisch-nachhaltige Stadt wird oft mit möglichst vielen Grünflächen in Verbindung gebracht. Singapurs Landschaft ist jedoch bereits bestens «bedient» mit grünen Gebieten und ist gleichzeitig ein Paradebeispiel dafür, wie schnell sich allzu starke Bemühungen negativ auswirken können: Die Grünflächen wirken künstlich. Andrea Häberlin. /
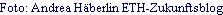 Viele der Parks sind unattraktiv und werden nicht richtig genutzt. Mein Team hat sich bewusst mit den bereits vorhandenen Flächen auseinandergesetzt. Auf leer liegenden Brachen können beispielsweise Arbeitsplätze in Form von Büros geschaffen werden. Unser Hauptanliegen war, Tampines in seiner natürlichen Form so gut wie möglich zu erhalten, um einen Ort in Singapur zu schaffen, der auch für soziale Interaktionen genutzt werden kann. Wir konzentrierten uns deshalb stark auf das Gebiet rundherum. Gibt es Möglichkeiten, Einwohner in bereits vorhandene Siedlungen zu integrieren? Wo können die Blocks noch dichter gebaut werden? Wenn wir umliegende Gebiete in unser Projekt einbinden, bevor wir das zur Verfügung gestellte Land verbauen, können die natürlichen Flächen auf Tampines erhalten werden. So reduzieren wir «the artificial greenery» - die künstliche Begrünung - in Singapur zu Gunsten eines Orts, an dem sich die Einwohner wohlfühlen. Wir nannten diesen Ort: «HOME». Das Gefühl zu Hause zu sein Singapurs Bevölkerungsdichte ist enorm. Neben Wohnräumen werden nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch ein effizient funktionierendes Transportsystem benötigt. Es war nicht einfach, mit einem detaillierten Lösungsvorschlag vor die Jury zu treten, der sowohl Urban Design als auch Network Design beinhaltet. Obwohl Singapur bis jetzt im Bezug auf die Stadtplanung einen sehr guten Job geleistet hat, nehmen wir immer noch diese künstliche-monotone Atmosphäre wahr. Mit unserem Projekt versuchten wir, mehr Raum für Identität zu schaffen - mehr Raum, in dem soziale Interaktionen stattfinden können. Denn der Mensch ist ständig auf der Suche nach jenem «home-feeling» - er wird je länger je mehr einen Ort brauchen, an dem er kreativ sein kann, einen Ort fernab des Alltagsstresses, einen Ort zum Sein. Links zum Artikel:
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|