|
Freitag, 8. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Die sieben gängigsten Fehlbeurteilungen der EU1. Die Europäische Union ist eine Erfindung der Grosskonzerne, damit diese überall geschäften können.Christian Müller, infosperber / Quelle: pd / Freitag, 14. Februar 2014 / 12:44 h
Richtig ist: Die Europäische Union ist im Nachgang des Zweiten Weltkrieges entstanden. Sinn und Ziel war, künftig innereuropäische Kriege, wie es sie in den hundert Jahren davor immer wieder gegeben hatte - mit vielen Millionen Toten! - zu vermeiden. Dieses Ziel ist erreicht worden. Der Friede in Europa ist aber keine Selbstverständlichkeit, wie etwa die Jugoslawienkriege in den 1990er Jahren gezeigt haben. Ohne EU würde die Gefahr innereuropäischer Kriege wieder massiv zunehmen.
2. Die Europäische Union mischt sich in alle Kleinigkeiten ein.
Richtig ist: Die Europäische Union versucht nicht, sich auf allen Ebenen einzumischen. Sie kümmert sich um jene Dinge, die eben europäisch oder generell international geregelt werden müssen, weil sie im Zeitalter der Globalisierung auf nationaler Ebene nicht mehr geregelt werden können.
3. In der Europäischen Union hat der schweizerische Föderalismus keinen Platz.
Richtig ist: Die Europäische Union überlässt die innenpolitische Entscheidungsfindung den einzelnen Mitgliedstaaten. Dass die Schweiz zum Beispiel das Bildungswesen in die Kompetenz der Kantone gelegt hat, ist der EU egal. Der Beitritt der Schweiz zum Bologna-Programm etwa erfolgte 1999 ohne politischen Meinungsbildungsprozess und wurde - in etwas gar selbstherrlicher Interpretation der ihm zustehenden Kompetenzen - durch einen Schweizer Staatssekretär eigenhändig unterzeichnet. Gewehrt hat sich danach aber niemand.
4. Die Europäische Union kennt keinen Minderheitenschutz.
Richtig ist: Die Europäische Union nimmt bei wichtigen Entscheidungen sogar mehr Rücksicht auf die einzelnen Mitgliedstaaten als etwa die Schweiz auf die einzelnen Kantone. Bei Abstimmungen braucht es in der Schweiz das Ständemehr, in der EU braucht es Einstimmigkeit. Wäre die Schweiz EU-Mitglied, hätte auch sie bei vielen Entscheidungen ein Vetorecht.
5. In der Europäischen Union hat das Volk kein Recht mehr auf eine Volksinitiative.
Richtig ist: Die Europäische Union kennt das Recht auf eine Volksinitiative auch, und es braucht dazu, in Prozent der Anzahl Einwohner, sogar weniger Unterschriften als in der Schweiz. Dass es noch nie zu einer Initiative gekommen ist, hängt nicht an der EU selber, sondern daran, dass die politischen Partei-Strukturen immer noch national organisiert sind und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der politischen Parteien immer noch in den Kinderschuhen steckt.
6. Die Europäische Union ist nicht föderalistisch, sondern zentralistisch.
Richtig ist: Die Europäische Union ist durchaus föderalistisch, nur heisst das Programm dort «Europa der Regionen». Das Wort «föderalistisch» kann die EU aus einem sprachlichen Grund nicht einsetzen: Im englischen Sprachbereich bedeutet «Federalism» oft die politische Organisation eines Staatenbundes mit Ausrichtung auf die zentrale Gewalt, hat also eine andere Bedeutung.
7. Die Europäische Union vertritt nur die Interessen der grossen Konzerne.
Richtig ist: Die Europäische Union vertritt nicht einseitig die Interessen der internationalen Konzerne, sie ist im Gegenteil eine der wenigen Instanzen, welche dem transnationalen Wuchern der «Global Players» gegebenenfalls Grenzen setzen kann.
Auch die Schweiz profitiert vom erreichten Frieden in Europa massiv. /
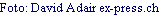 Sie tut das aber vor allem, wenn innerhalb der EU selber solches vorgeschlagen und aktiv gefordert wird. Dabei ist jede interne Stimme mitentscheidend. Anmerkungen Zu 1. Auch die Schweiz profitiert vom erreichten Frieden in Europa massiv. Ohne diesen stabilen Friedenszustand hätte sie ihre Armee nicht auf unter die Häfte der Kosten reduzieren können. Zu 2. Dass sich die EU gelegentlich auch bemüssigt fühlte, gemeinsame Regelungen einzuführen, die nicht prioritär waren, ist unbestritten. All diese unerwünschten Standardisierungen erfolgten aber nicht aus eigenem Zentralisierungsantrieb, sondern meist auf Wunsch des Handels zur Vereinfachung des internationalen Vertriebs. Zu 3. Das in der Schweiz gelebte Prinzip der Subsidiarität (Entscheidungskompetenz auf der unterstmöglichen Stufe) wäre bei einem Beitritt zur EU nicht hinfällig. Es gäbe lediglich oben an der Bundesebene noch eine weitere, höhere Kompetenzebene, eben für national nicht mehr regelbare Probleme. Zu 4. Das Vetorecht der einzelnen Staaten ist zwar aus Sicht des Minderheitenschutzes positiv, in der Entscheidfindung aber ein grosses Hindernis. Hier könnte die EU von der Schweiz lernen: durch Reduzierung von partikulären Vetorechten. Es kann zum Beispiel nicht sein, dass Grossbritannien mit dem Finanzplatz London die Einführung der Tobin Tax auf ewig blockiert. Zu 5. Das bestehende Recht zur Volksinitiative wird in der EU bisher auch deshalb nicht wahrgenommen, weil es an der Erfahrung damit mangelt. In diesem Punkt könnte die Schweiz positive Impulse in die EU einbringen. Zu 6. Die Fördergelder zum Beispiel, die von der EU gesprochen werden, gehen nicht nach Frankreich oder nach Polen, sondern zum Beispiel in die Bretagne oder in die Region Krakau. Damit bekräftigt die EU das Prinzip «Europa der kulturellen Vielfalt». Zu 7. Das Problem der zunehmenden Macht der Grosskonzerne ist tatsächlich virulent und darf auf keinen Fall übersehen werden. Die transnationalen Konzerne wollen weltweit tun und lassen, was ihnen beliebt, ohne Rücksicht auf regionale Kulturen und Eigenheiten. Gerade die Zähmung dieser neuen Feudalherren aber ist ein wichtiger Grund, warum auch die Schweiz Mitglied der EU werden sollte. Da kann sie mehr Einfluss gewinnen, als sie jetzt hat. Jetzt beschränkt sie sich darauf, von diesen Konzernen zu profitieren - zum Schaden Anderer. Leider. Links zum Artikel:
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|