Eine jede Generation hat seit dem späten Miozän das Recht und sicher auch guten Grund, auf die eigene Vorgeschichte zurückzublicken und in schwärmerische Verzückung zu geraten. Der eine zog sich dabei gedankenversunken eine Laus aus der dichten Ganzkörperbehaarung, staunte ob seinem effektiven Pinzettengriff und vernaschte den Blutsauger, während er sich erinnerte, wie sein Grossonkel zum ersten Mal einen schweren Ast vom Boden aufgehoben, ihn über seinen Kopf geschwungen und krachend im Grosshirn seines Schwagers platziert hatte, dessen Töchter und Essensreste in der Folge an ihn übergingen.
Ein anderer lächelt heute noch verzückt beim immer noch vernebelten Gedanken an jenen Sommer, in dem er Marihuanaverklärt und LSD-erweitert erst seine Freundin, dann deren Freundin und schliesslich eine Unbekannte, die in seinem VW-Bus mit nach Woodstock gefahren war, geschwängert, zu Jimi Hendrix «Star Spangled Banner» ein bis zwei Liter Jack Daniels auf das matschige Feld erbrochen und die Woche darauf seinen Marschbefehl nach Vietnam erhalten hat, wo er endlich zum Mann wurde und einsah, dass es erst Frieden geben würde auf der Welt, wenn Onkel Sam auch den hinterletzten Kommunisten aus seinem Rattenloch gescheucht und kaltgemacht hatte. - A propos Jimi Hendrix: Er, der schwarze Mozart der Neuzeit, besang in und mit seiner Musik gleichsam den Höhepunkt und das Ende der letzten echten Revolution auf diesem Planeten. Gesät in den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts von den Vätern des Rock and Roll, zur vollen Blüte gelangt und geerntet in den Swinging Sixties - impotent und dement vermodert im Plastik der Siebziger.
Seither: blosse Wiederholung, auf allen Kanälen. Will heissen, es gibt nichts, wirklich gar nichts, was in den Folgejahren passiert oder propagiert worden wäre, das aus heutiger Sicht die Verwendung von Goldfarbe bei der Aufzeichnung von Erinnerungen rechtfertigen würde. Alles, wirklich alles, was in den an Trostlosigkeit nicht zu überbietenden Erinnerungs- und Revivalanlässen sowie und vor allem Medienbeiträgen zum Thema «Achtzigerjahre» aufgetischt wird, ist nichts anderes als eine von historisch wie naturwissenschaftlich gänzlich unbeleckten Irrgeistern angestachelte Überhöhung eines hinlänglich bekannten Phänomens, des Booms vor der Rezession.
Nach der Rezession folgt die Depression, und in dieser Situation neigen schwache Gemüter dazu, den Blick zurückzuwenden auf die vermeintlich besseren Tage.



/
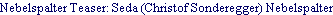



/
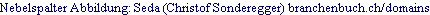

Da stellt sich allerdings die berechtigte Frage, was denn so besonders gut daran ist, wenn sich ein Primarschüler vom Christkind keinen Hund mehr wünscht zu Weihnachten, sondern einen Donkey Kong von Nintendo. Der kulturbeflissene Mensch mit dem Fluch der frühen Geburt wird nichts Besseres in einer Musik finden, die sich «Neue Deutsche Welle» nennt, im Grunde aber weder neu noch wellenförmig und bis auf die Sprache auch nicht wirklich deutsch daherkommt. Kinderlieder gab es lange vor den NDW-80ern, kindische Erwachsene und Jugendliche ebenso. Liegengebliebenen Kompositionsabfall aus den 70ern mit simpelster Elektronik wiederzubeleben, ist keine Kunst. Seine Haare bunt einzufärben, Kleider aus der Brockenstube wild zu kombinieren, sich mit grossen Schmuckstücken zu zieren und mehr Fun zu fordern, das haben die Kinder der Sechzigerjahre mit mehr Fantasie, mit grösserer Musikalität und aus notwendiger Überzeugung schon getan.
Das genialste Spielzeug der Achtziger, der Rubik-Würfel, wurde schon in den Siebzigerjahren entwickelt, notabene von einem hochintelligenten Bildhauer, Architekten und Designer mit Jahrgang 1944, Ernö Rubik. Ja, zugegeben, Steve Jobs lancierte 1984 den Macintosh- Computer, und Bill Gates begründete mit MS-DOS nicht nur sein Milliardenvermögen, sondern auch die dereinst daraus resultierende Rückkehr des Menschen in die Steinzeit. Doch Hand aufs Herz: Sind das genug Gründe, die Achtziger zu feiern? Die Losung für alle zu spät Geborenen heisst: Lest und lernt aus der Geschichte, versucht nicht, golden zu malen, was bestenfalls kupferfarben glänzt und sorgt dafür, dass die Menschheit die nächsten Achzigerjahre zu etwas tatsächlich Erinnerungswürdigem macht.