|
Donnerstag, 21. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Twitter-Stress macht Journalisten krankIn der Schweiz setzt die omnipräsente Zurschaustellung eines vermeintlich blitzgescheiten Kopfes Journalisten stark unter Druck. Das zeigt eine neue, repräsentative Umfrage.Carole Starrmilch / Quelle: Nebelspalter / Montag, 20. Oktober 2014 / 18:08 h
Das pausenlose Getwittere der Berufskollegen gaukelt Medienschaffenden die Illusion vom perfekten Journalisten vor. Viele sind dadurch so verunsichert, dass sie Selbstzweifel, Depressionen oder gar einen anomalen Kaffeekonsum entwickeln. Daher startet die Stiftung Pro Mediocris eine neue Kampagne.
Mit dem Slogan «Viele Journalisten haben mit den echten Lesern nichts zu tun» sollen die Medienschaffenden darin bestärkt werden, sich nicht mit überhöhten Online-Idealen unter Druck zu setzen, wie Pro Mediocris in einer Mitteilung schreibt.
Die Problematik hat sich in den letzten Jahren durch den hohen Stellenwert der Neuen Medien zunehmend verstärkt. Durch das ununterbrochene Posten von scharfsinnigen, coolen, witzigen und sachkundigen Kommentaren und durch das Retweeten von möglichst beeindruckenden Meldungen aus fremdsprachigen Weltblättern oder aus hochstehenden Fachforen werde ein überstilisiertes Idealbild des Journalisten geschaffen, wie es in der Mitteilung heisst. So fällt das Selbstbild nicht mehr nur im Vergleich mit Stars wie Frank A. Meyer, Patrik Müller und Roger Köppel ab, sondern auch gegenüber normalen Berufskolleginnen und -kollegen.
Ziel: Scharfsinnigkeit, Coolness und Eloquenz Dies belegt auch eine repräsentative Umfrage von Pro Mediocris unter den 983 noch nicht durch Praktikanten ersetzten ausgebildeten Medienschaffenden in der Schweiz: 100 Prozent der Befragten gab an, es am wichtigsten zu finden, von anderen Journalisten positiv wahrgenommen zu werden. 88 Prozent wollen als intellektuell, 76 Prozent als schlagfertig gelten. /
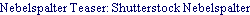 Bei 67 Prozent der Schreibenden führt der Vergleich mit anderen zu grosser Verunsicherung oder gar zu Krisen. Jeder Dritte erlitt in den letzten Jahren sogar ein so genannten Mug-out und verlor über Nacht die Lust auf die täglichen 15 Tassen Kaffee. Mehrmals am Tag wenden sich Journalisten an die Notrufnummer 143 und berichten über Sorgen im Zusammenhang mit ihrem Selbstwertgefühl und ihrem Ansehen. Entgegen herkömmlicher Vorstellungen ist für Tagesjournalisten Intellektualität genauso wichtig wie für Edelfedern. Da gebe es etwa einen 32-jährigen Lokaljournalisten, der seit Monaten verzweifelt versucht, einen Tweet zu kreieren, der gleichzeitig von @hansi_voigt, @metamythos, @christof_moser und @redder66 favorisiert oder retweetet wird. Ein 45-jähriger habe vor lauter Social-Media-Präsenz kaum Zeit, seine Offline-Arbeit zu erledigen, weil er Angst habe, ohne hohen Klout-Score nie eine neue Stelle zu finden, berichtet eine Pro-Mediocris-Beraterin. Journalisten, die erst einmal in diese Selbstzweifel geraten, könne man nur langsam wieder in die Normalität zurückhelfen. «Zu begreifen, dass Twitter eine parallele Scheinwelt ist und dass 95 Prozent aller Tweets weder gelesen noch kommentiert werden, das braucht Kraft und Zeit», erklärt die Mitarbeiterin von Pro Mediocris. Total an den Lesern vorbei «Besonders bemerkenswert ist, dass sich ein hoher Prozentsatz aller Journalisten-Tweets um die Frage drehe, wie ein künftiger Journalismus auszusehen habe, der wieder mehr Leser generieren könnte.» Meistens folge darauf die Einsicht, man müsse besser hinhören, was die Leser wirklich interessiere und bewege. «Und dennoch findet diese Debatte in einem virtuellen Raum statt, in dem sich in der Schweiz - neben einigen Politikern und Promis - fast ausschliesslich Journalisten gegenseitig followen», so die Mitarbeiterin weiter, bevor sie sich ihrem Smartphone zuwendet, um mit zittrigen Händen für den Kampagnenstart einen möglichst eingängigen Tweet mit hohem viralem Potenzial zu texten. Der umgekehrt hingestellte Kaffee-Mug neben ihr wirkt mit seiner leichten Staubschicht schon seit längerem unbenutzt.
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|