Der Bericht beleuchtet die verschiedenen Szenarien für den weiteren europapolitischen Weg der Schweiz. Die Beschlüsse, die der Bundesrat an der Klausur gefällt habe, seien in den Bericht eingeflossen, schreibt das Aussendepartement (EDA) in einer Mitteilung zum Bericht.
Bundespräsidentin Doris Leuthard hatte nach der Klausursitzung eingeräumt, dass der bilaterale Weg schwieriger werde. Im Bericht ist von einer «Erosion des Handlungsspielraums» der Schweiz im bilateralen Verhältnis zur EU die Rede.
Automatismus ausgeschlossen
Zwar sei die EU im Grundsatz nach wie vor interessiert am Abschluss bilateraler Abkommen. Sie verlange aber nicht nur die vollständige Übernahme des relevanten Rechtsbestandes, sondern auch von dessen Weiterentwicklungen.
Der Bundesrat bekräftigt, dass dies für ihn nicht in Frage kommt: «Für die Schweiz ist jeder Automatismus bei der Übernahme von Rechtsentwicklungen ausgeschlossen», heisst es im Bericht.



«Der bilaterale Weg wird schwieriger», erläuterte Doris Leuthard. /
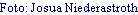

Diese Entwicklungen dürften den bilateralen Weg nicht verunmöglichen, schreibt der Bundesrat. Es könne davon ausgegangen werden, dass beide Seiten ein Interesse hätten, vertragliche Lösungen zu suchen.
EWR: Schwächung der Autonomie
Im Bericht werden auch die Vor- und Nachteile eines Beitritts zum EWR oder zur EU analysiert. Was den EWR betrifft, hält der Bundesrat fest, ein Beitritt würde die schweizerische Autonomie schwächen.
Der Handlungsspielraum von Bundesrat und Parlament würde durch die Verpflichtung zur Übernahme von EU-Recht eingeschränkt. «Die Auswirkungen auf die Handlungsfreiheit der Schweiz dürften ausgeprägter sein als beim bilateralen Weg,» steht im Bericht. Allerdings würde die Rechtssicherheit erhöht.
Was die EU betrifft, hält der Bundesrat fest, die Schweiz hätte als mittelgrosser Mitgliedstaat keine Garantie, dass die Entscheidungen der EU immer in ihrem Sinne wären.