Gut integrierten jugendlichen Sans-Papiers eine Berufsbildung zu ermöglichen und ihnen damit den Einstig ins Erwerbsleben zu erleichtern, liege auch im Interesse der Schweiz, sagte EKM-Präsident Francis Matthey am Montag vor den Medien.
Denn die Zahl der Schulabgängerinnen und -abgänger sei rückläufig, was sich auch auf die Berufsbildung auswirken werde. Gewisse Branchen hätten bereits Mühe, die Lehrstellen zu besetzen. Werde nicht genügend Nachwuchs ausgebildet, führe das zu einem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften.
Lehre dem Gymnasium gleichstellen
Der Bund solle deshalb die Voraussetzungen dafür schaffen, dass in der Schweiz geborene jugendliche Papierlose oder solche, die mindestens fünf Jahre der obligatorischen Schulzeit in der Schweiz absolviert haben, zur Berufslehre zugelassen werden.
Heute dürfen diese Jugendlichen keine Lehre machen, da sie mangels Aufenthaltsberechtigung keinen Arbeitsvertrag abschliessen dürfen. Der Gang aufs Gymnasium oder eine andere nachobligatorische Schule wird dagegen in manchen Kantonen erlaubt.
Dass dies ungerecht ist, fanden auch die Eidg. Räte.



Heute dürfen diese Jugendlichen keine Lehre machen, da sie mangels Aufenthaltsberechtigung keinen Arbeitsvertrag abschliessen dürfen. /
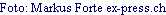

Mit einer Motion beauftragten sie den Bundesrat, den Jugendlichen eine Berufslehre zu ermöglichen.
Ob es aber auf Bundesebene tatsächlich zu einer Lösung kommt, ist offen. Die Frage ist derart umstritten, dass die staatspolitische Kommission des Nationalrats nur einen Monat nach Überweisung der Motion eine gegenteilige Position vertrat. Die Kommissionsmehrheit befürchtet, dass die Berufslehre letztlich in eine generelle Legalisierung mündet.
Pragmatische Ansätze weiter verfolgen
Eine kollektive Regularisierung hält Francis Matthey für die Schweiz nicht für realistisch. Gleichzeitig zeigte er sich überzeugt, dass die illegale Zuwanderung mit den restriktiven Zulassungsregeln und dem repressiven Vorgehen nicht vollständig verhindert werden kann.
Illegal Migration gehöre zu einer globalisierten Welt. Solange die Nachfrage nach «solchen Arbeitskräften» vorhanden sei, bleibe sie bestehen. Wie viele es derzeit genau sind, ist unklar. Schätzungen gehen von 70'000 bis 180'000 Personen aus.