|
Donnerstag, 7. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Meinungen zur Frankenstärke driften weit auseinanderZürich - Die Meinungen über geeignete Massnahmen gegen die Frankenstärke gehen weit auseinander. In der Sonntagspresse diskutieren Experten über Lohnanpassungen, Erhöhung der Wochenarbeitszeit und Sonderzinse für die Schweizer Exportwirtschaft.asu / Quelle: sda / Sonntag, 24. Juli 2011 / 11:37 h
So dürfen etwa für Hans-Ulrich Bigler, den Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands (SGV), Lohnanpassungen aufgrund des starken Frankens kein Tabu sein. Nur so liessen sich Arbeitsplätze erhalten, wenn Schweizer Unternehmen wegen weggebrochener Margen Verluste schrieben.
In einem Interview im «SonntagsBlick» spricht Bigler aber ausdrücklich von befristeten Lohnanpassungen. Zudem soll zuerst auf Basis der Sozialpartnerschaft versucht werden, die Arbeitszeit der Angestellten zu verlängern.
Einen solchen Schritt zur Steigerung der Produktivität haben einzelne Unternehmen bereits eingeleitet oder umgesetzt, so beispielsweise der Pharma- und Biochemiekonzerns Lonza oder der Verpackungshersteller Model.
Erhöhung der Arbeitszeit Als zumutbar erachtet Bigler eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit um zwei Stunden. Diese zusätzlichen Arbeitsstunden wie in Krisenzeiten die Kurzarbeit über die Arbeitslosenversicherungen (ALV) abzugelten, hält Bigler dagegen für keine gute Idee. «So häuft man nur neue Schulden bei der ALV an», sagte er. Zu längeren Arbeitszeiten äusserte sich auch der Präsident des SGV, Bruno Zuppiger: In der «NZZ am Sonntag» macht er den Vorschlag, dass die Überzeit gutgeschrieben und später verrechnet werden könne. Generell dürfe nicht vergessen werden, dass an der Volkswirtschaft Arbeitgeber und Arbeitnehmer beteiligt seien.Lohnanpassungen aufgrund des starken Frankens dürfen kein Tabu sein. /
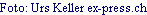 Ein Engagement für die Exportindustrie wünscht sich Zuppiger auch von den Banken: Wenn der Finanzplatz von der aktuellen Situation profitiere, müssten die Banken auch die exportorientierten Firmen unterstützen. Etwa mittels einer Erhöhung von Kreditlimiten oder eines Sonderzinses für die Exportwirtschaft. Umstrittene Zinserhöhung Jan-Egbert Sturm, der Direktor der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF), erteilt derweil allen Vorschlägen, die als Massnahmen gegen die Frankenstärke vorgebracht worden sind, eine Abfuhr. Man müsse realisieren, dass man derzeit nicht sehr viel tun könne, sagte er. Für die Koppelung des Schweizer Frankens an den Euro sei es jetzt, wo der Euro 1.17 Franken koste, nicht der richtige Zeitpunkt, sagte Sturm im Interview mit der Zeitung «Der Sonntag». Wenn überhaupt, hätte der Franken bei einem Kurs von 1.50 an die europäische Gemeinschaftswährung gekoppelt werden müssen. Auch von einer Zinserhöhung hält Sturm nicht viel: Für die Binnenwirtschaft wäre eine solche zwar angebracht. Für die Exportwirtschaft würde ein Zinsschritt aber einen weiteren Dämpfer bedeuten, weil dadurch der Franken noch attraktiver würde. Steuererleichterungen für die vom starken Franken gebeutelte Exportindustrie wiederum bezeichnet der KOF-Direktor als Subventionen, welche strukturelle Veränderungen blockieren und so falsche Anreize setzen würde. Einzig bei einer temporären Frankenstärke wären Steuererleichterungen eine sinnvolle Überbrückungsmassnahme.
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|