|
Sonntag, 17. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Bundesrat für längere Haftpflicht-AnsprücheBern - Wer Opfer einer Körperverletzung oder einer Sachbeschädigung wurde, soll künftig seine Schadenersatzansprüche länger geltend machen können. Der Bundesrat will die Verjährungsfristen im Haftpflichtrecht verlängern.dyn / Quelle: sda / Mittwoch, 31. August 2011 / 13:40 h
Ziel sei es, Geschädigte bei Spät- und Langzeitschäden besser zu schützen, schreibt das Bundesamt für Justiz (BJ). Darüber hinaus will der Bundesrat das gesamte Verjährungsrecht im Privatrecht vereinheitlichen.
Am Mittwoch hat er die Vernehmlassung zu einer entsprechenden Revision des Obligationenrechts eröffnet. Es geht dabei allgemein um die Frage, wie lange ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner Forderungen durchsetzen kann.
Einheitliche Regeln Das geltende Recht regelt die Verjährung nicht einheitlich. Neben den allgemeinen Bestimmungen im Obligationenrecht gibt es zahlreiche Sonderbestimmungen. Das Verjährungsrecht sei dementsprechend kompliziert, schreibt das BJ. Auch gälten die Verjährungsfristen im Deliktsrecht als zu kurz. Neu sollen die allgemeinen Bestimmungen des Verjährungsrechts für sämtliche privatrechtlichen Forderungen gelten - unabhängig davon, ob sie aus einem Vertrag, einer unerlaubten Handlung oder aus ungerechtfertigter Bereicherung entstanden sind.Bei Sachbeschädigungen soll das Opfer zukünftig länger auf Schadenersatz pochen können (Symbolbild). /
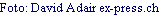 30 Jahre bei Personenschäden Künftig soll es für alle Forderungen doppelte Fristen geben: Eine relative Frist von drei Jahren und eine absolute Verjährungsfrist von zehn Jahren. Für Forderungen aus Personenschäden schlägt der Bundesrat eine Höchstdauer von dreissig Jahren vor. Die relative Frist beginnt erst zu laufen, wenn der Gläubiger den erlittenen Schaden bemerkt hat und über Kenntnis der Person des Schuldners verfügt. Die absolute Frist dagegen beginnt bereits mit der Fälligkeit der Forderung. Für Schadenersatzforderungen soll nach dem Willen des Bundesrates der Zeitpunkt des Vorfalls massgeblich sein, welcher den Schaden verursacht hat. Das Konzept der doppelten Fristen ist im Deliktsrecht erprobt. Es entspreche der Regelung in umliegenden Ländern, heisst es im Bericht zur Vernehmlassung. Zu den Vorschlägen des Bundesrates können sich Parteien und interessierte Kreise bis zum 30. November äussern.
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|