|
Mittwoch, 6. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Obama n'existe pas...Alles in allem habe ich drei Jahre in den USA gelebt. Wer mich nach zwei Wochen US-Aufenthalt hört, würde dank breitem Kaugummi-Hi und Strahlelächeln den Unterschied zwischen einer Kalifornierin und der Bernerin nicht mehr hören.Regula Stämpfli / Quelle: news.ch / Donnerstag, 4. Oktober 2012 / 10:09 h
Nach der Romney-Obama-Debatte ist jedoch wieder kristallklar: Ich kann vielleicht noch wie eine Amerikanerin klingen, bin aber vom «American way of life» Lichtjahre entfernt. Es ist wie wenn man nach langen Jahren Abwesenheit wieder einmal seine Familie besucht, Ähnlichkeiten, Vertrautheiten entdeckt, doch eine Fremde spürt, die unendlich schmerzt.
Egal ob Barack Obama gewählt wird oder nicht (und selbst bei grösstem Zynismus muss man dies wohl vernünftigerweise wünschen, oder?): er wird als brutalste Enttäuschung der progressiven, demokratischen und reformerischen Kräfte der Geschichte eingehen. Als erster Schwarzer der amerikanischen Geschichte hat er in den letzten vier Jahren nichts für die sogenannten Minderheiten getan. Als Mandatsträger einer grossen Mehrheit, welche die Wallstreet bestrafen und neu regulieren sollte, hat er genau das Gegenteil praktiziert.
Als Friedensnobelpreisträger setzte er, wie kein anderer Präsident vor ihm, mechanisierte Tötungsmaschinen ein. Als Ehemann einer hochkarätigen Juristin, die sich jahrzehntelang für Frauen- und Bürgerrechte eingesetzt hat, betreibt er eine der antifeministischsten Politiken, welche die USA unter einem demokratischen Präsidenten ertragen musste. Unter den engen Obama-Beratern ist ausser seiner Ehefrau und Hillary Clinton kein einziges weibliches Wesen mit politischem Gewicht zu finden. Im Vergleich zu Obamas Kabinett sieht selbst ein George W. Bush wie ein Feminist aus.
Genauso begann Obama seine Fernsehdebatte indem er meinte, dass er der «luckiest man on earth sei, weil Michelle Obama ihn geheiratet habe»: «Sweetie, happy anniversary and I promise you, a year from now we will not celebrate it in front of 40 million people» (Schönes Jubiläum, Süsse, und ich versprech Dir, wir feiern das in einem Jahr nicht vor 40 Millionen Menschen).
Bei diesem ersten Satz, den natürlich keine der amerikanischen Kommentatoren als schockierenden Kernsatz entlarvte, war alles schon klar.
Barack Obama klang wie eine schlechte Kopie von Romney. Während ein Mormone durchaus seine Karriere nur auf dubiosen Finanzgeschäften aufbauen kann und glücklich verheiratet sein darf mit einer Frau, deren Leben aus Krankheit, Kindern und Charity besteht, ist von einem Demokraten eigentlich anderes zu erwarten. Doch Barack Obama will genau das nicht: Anders sein. Im Grunde seines Herzens wäre Barack Obama wohl glücklich, er wäre Mitt Romney. Denn Obamas Politik klingt zwar anders, doch sie sieht der Politik der Republikaner verdammt ähnlich. Vielleicht können amerikanische Demokraten nur in einem wirklich gut sein: Das Schlimmste zu verhindern...
All dies zeigt sich in seinen ersten Sätzen und Minuten. Die Debatte war damit schon gelaufen. Barack Obama hat die Debatte nicht verloren wie alle Kommentatoren meinen: Nein, er war einfach nur so, wie er die letzten vier Jahre regiert hat - ein Versager, ein Zögerer, ein Lippenbekenner, ein Angepasster.
Barack Obama kam in der Debatte genauso rüber: Er ist und bleibt ein Copy-Paste-Produkt, auf welches vor vier Jahren alle fortschrittlichen Kräfte hereingefallen sind. Nirgendwo ist dies sichtbarer als mit diesem ersten Satz, in welchem er von seiner Ehefrau als «Sweetie» redet und von sich selber behauptet, «der glücklichste Mann zu sein», wenn er genau das Gegenteil ausstrahlt.
Versager gegen grässlichen Monsterkapitalisten: Wenigstens einer ist autentisch. /
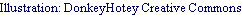 Und seine Ehefrau ist sicher Vieles, aber eine «Sweetie» sicher nicht. «Where was Obama?» fragte ein Twitter während der Debatte. Richtig. Barack Obama war nicht nur nicht in dieser Debatte nicht präsent, ihn gibt es wahrscheinlich auch nicht. Vor vier Jahren segelte er als Copy-Paste-Produkt der Mediendemokratie ins höchste Amt der Welt. Wie haben wir gejubelt! Wie haben wir gemeint, endlich, die Welt ändert sich! Wir wurden wie Kinder, die sich auf eine Party, Liebe und Zuneigung freuen, so arg und brutal geprügelt, dass wir unser Leben lang diese Narben und dieses Trauma tragen werden. Obama schaffte es innert kürzester Zeit, das einzige sozialdemokratische, auf Chancengleichheit beruhende, bildungsorientierte und einigermassen demokratisch organisierte System, sprich die europäischen Länder, mit mehreren Angriffen via Finanzsystem und Ratingagenturen sowie seiner Zinspolitik, fast zu zerstören. Der erste Satz von Obama zeigte mit schockierender Deutlichkeit: Toni Blair war nur eine Vorspeise dessen, was sogenannt progressive Politiker alles versemmeln und zerstören können. Nach diesem einen Satz, nach diesem Anfang wünscht selbst die progressivste, politisch interessierte Bürgerin: Bitte, bitte, wählt Romney! Während der Debatte wird klar, dass selbst Barack Obama merkt, was er war und bleibt. Ein «Phoney» - ein «Tut so als ob». Deshalb konnte er nicht punkten. Denn irgendwie muss ihn das Gefühl überwältigt haben, wie alles anders ist als noch vor vier Jahren, als er mit dem Auftrag gewählt wurde, die Welt und den galoppierenden Finanzkapitalismus zu bremsen, zu reformieren und zu gestalten und unfassbar versagte. Es muss ihm während der Debatte klargeworden sein, dass er zu Occupy nicht ein Wort gesagt hat, dass er die Truppen, die brutal Occupy räumten, nicht mit einem kleinen Wink, hätte bremsen wollen. Dass er überhaupt nie jemals etwas anderes war als eine Marionette der Wallstreet. Ohne Psychologin zu sein, doch der Unterschied zwischen Wort und Inhalt liess sich auf Obamas Gesicht sprichwörtlich ablesen: Seine Sätze über die Finanzkrise klangen eigentlich so: «Vor vier Jahren steckten wir in der grössten Finanzkrise der amerikanischen Geschichte und... und... und... ich habe jede Chance vertan!» Schauen Sie selber rein und Sie merken sofort, was ich meine. Barack Obama stockt so sehr, dass klar ist, was er ganz zu Recht von sich selber denkt: «Ich bin ein totaler Versager.» Barack Obama sprach Sätze wie: «Wir müssen in Erziehung und Bildung investieren» während sein Ausdruck sagte: «Wir werden das nie schaffen.» Barack Obama hat die Debatte nicht verloren, sondern er hat uns einen Politiker gezeigt, der keine Verbindung hat zwischen dem, was er sagt und dem was er tut. Der realisiert, dass er die letzten vier Jahre Wasser predigte, aber Wein trank. Deshalb hat Mitt Romney gewonnen. Was der sagt und tut ist zwar grässlich, doch wenigstens authentisch. Und das bringt in einer Mediendemokratie mehr Punkte als ein offensichtliches Copy-Paste-Produkt und ehrlich gesagt? Bei allen Kopf-Argumenten für Obama, der Bauch sprach eine andere Sprache...
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|