|
Mittwoch, 20. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Ozeanzirkulation beeinflusst CO₂-Konzentration der AtmosphäreDie CO₂-Konzentration in der Atmosphäre war während den vergangenen Eiszeiten niedriger als in den vorhergehenden Warmzeiten sowie der jetzigen (Holozän). Wir Forscher sind uns weitgehend einig, dass die Tiefenzirkulation in den Ozeanen die Verteilung von Kohlenstoff zwischen der Atmosphäre und der Tiefsee beeinflusste.Dr. Samuel Jaccard / Quelle: ETH-Zukunftsblog / Freitag, 24. Mai 2013 / 13:46 h
Veränderungen der ozeanischen Tiefenzirkulation haben in der Vergangenheit dazu geführt, dass sich die CO₂-Konzentration der Atmosphäre während Eiszeiten und Warmzeiten unterscheidet. So haben eiszeitliche Veränderungen der ozeanischen Tiefenzirkulation dazu geführt, die Menge an in der Tiefsee gespeichertem CO₂ zu erhöhen. Beim Übergang in eine Warmzeit veränderte sich die ozeanische Tiefenzirkulation wieder, sodass das gespeicherte CO₂ zurück in die Atmosphäre entweichen konnte. Dort trug es durch den Treibhauseffekt zur Erwärmung der Erde bei.
Biologische Pumpe Während sich die oberste Schicht des Ozeans weitgehend im Gleichgewicht mit der Atmosphäre befindet, enthält die Tiefsee rund sechzig Mal mehr CO₂ als die Atmosphäre. Verantwortlich für diesen Unterschied ist die sogenannte biologische Pumpe: Algen nehmen zum Wachsen CO₂ aus dem Oberflächenwasser auf. Nach ihrem Tod sinkt ein Teil der abgestorbenen Algen bis in die Tiefsee, wo er bakteriell zersetzt wird. Dabei werden CO₂ und Nährstoffe wieder freigesetzt. Die Ozeanzirkulation bringt das CO₂- und nährstoffreiche Tiefenwasser an einigen Stellen (z.B. im Südozean) zurück an die Meeresoberfläche, wo dieses das Algenwachstum stimuliert. Das Verhältnis zwischen der Menge Kohlenstoff, die in der Tiefsee transportiert wird, und der Menge CO₂, die durch die Zirkulation wieder an die Meeresoberfläche gelangt, bestimmt längerfristig, ob CO₂ in die Atmosphäre entweicht oder vom Meer aufgenommen wird. Aus diesen Gründen spielt die Effizienz des Austausches zwischen der Tiefsee und der Meeresoberfläche eine entscheide Rolle bei der Steuerung der eis- und warmzeitlichen Klimavariabilität. Verstärkte CO₂-Ausgasung während vergangener Episoden globaler Erwärmung Während der Frühphase des Übergangs von der letzten Eiszeit in die jetzige Warmzeit (Holozän) wurden dem Nordatlantik grosse Mengen an Schmelzwasser zugeführt aufgrund des Abschmelzens der Eisschilde Amerikas und Europas. Dr. Samuel Jaccard ist Oberassistent und Dozent an der Professur für Klimageologie am Geologischen Institut der ETH Zürich. /
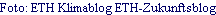 Dies schwächte die dichtegetriebene nordatlantische Tiefenwasserbildung ab. Dieser grundlegende Wandel in der Verteilung der Tiefenwasserströme führte zu einer Erwärmung des Südlichen Ozeans, der den antarktischen Kontinent umgibt. Dies bewirkte dort wiederum einen verstärkten Austausch zwischen Meeresoberfläche und Tiefenwasser und die Ausgasung von vormals in der Tiefsee gespeichertem CO₂ in die Atmosphäre. Unsere paläoklimatologischen Studien aus dem Südlichen Ozean zeigen, dass über die gesamte letzte Million Jahre bei den Übergängen von Eis- zu Warmzeiten die Menge des aus der Tiefsee entweichenden CO₂ mit dem Mass der globalen Erwärmung korrelierte. Des Weiteren zeigen unsere Arbeiten an subtropischen Ablagerungen, dass die Reorganisation der Tiefenwasserzirkulation unerwartete Konsequenzen für den Nährstoffhaushalt der niederen Breiten hatte. Das vorübergehende Verschwinden von im Nordatlantik gebildetem Tiefenwasser in der Frühphase der Übergänge ermöglichte ein Entweichen von Nährstoffen aus der Tiefsee. Die verstärkte Nährstoffzufuhr aus dem Ozeaninneren an die Meeresoberfläche der niederen Breiten zeigt sich anhand der ungewöhnlich hohen Produktivität von Kieselalgen, deren Schalen wir in den Sedimenten aus den Übergangszeiten fanden. Aus der Vergangenheit lernen Die Mechanismen der Klimavariabilität vergangener Epochen sind aus heutiger Sicht noch nicht gänzlich verstanden. Trotzdem können die beobachteten Folgen früherer globaler Erwärmungen wichtige Hinweise für die künftige Veränderung des Klimas liefern. Neue Studien zeigen, dass sich aufgrund von anthropogenen Einflüssen die globale Kohlenstoffaufnahme des Ozeans graduell verringert hat. Zudem zeigen geologische Archive, dass generell während wärmeren Episoden mehr Kohlenstoff aus dem Ozean entwich. Dies könnte darauf hinweisen, dass die CO₂-Aufnahme des Ozeans in Zukunft aufgrund der globalen Erwärmung der Erde weiter abnimmt und mehr CO₂ in der Atmosphäre bleibt. Diesen Beitrag hat Samuel Jaccard gemeinsam geschrieben mit Dr. Nele Meckler der ETH Zürich.
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|