|
Montag, 4. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Ständerat versenkt Initiative für eine öffentliche KrankenkasseDie Initiative «für eine öffentliche Krankenkasse» hatte am Montag in der kleinen Parlamentskammer nicht den Hauch einer Chance. Nur 13 Ständerätinnen und Ständeräte empfehlen sie dem Volk zur Annahme. 28 wollen nichts von einer Einheitskrankenkasse wissen, einige anerkennen aber Handlungsbedarf.fest / Quelle: sda / Montag, 9. Dezember 2013 / 19:45 h
In der ausführlichen Debatte zur medizinischen Versorgung und ihrer Leistungserbringung fielen Begriffe wie Sowjetisierung, Wartelisten, Verstaatlichung, Rationierung, Staatsmoloch oder Gleichmacherei.
Vor allem bürgerliche Politikerinnen setzten sich für das heutige System mit 61 Krankenversicherern ein und hielten den dadurch möglichen Wettbewerb hoch. Eine staatliche Einheitskasse könne das Problem der steigenden Gesundheitskosten nicht lösen, erklärte Urs Schwaller (CVP/FR) namens der vorberatenden Kommission.
Marktwirtschaftliche Logik Verbreitet wurde vor einem Monopolsystem mit fehlender Wahlfreiheit und fehlenden Anreizen zu einer sparsamen Gesundheitsversorgung gewarnt. Karin Keller-Sutter (FDP/SG) sprach von «Zwangsversicherten» bei einer Kasse. «Sie werden Bittsteller, denen keine andere Wahl mehr bleibt.» Für sie ist eine öffentliche Krankenkasse «der erste Schritt zu einem vollständig steuerfinanzierten Gesundheitswesen». Und Roland Eberle (SVP/TG) warnte davor, ein zweites Kostensystem zu generieren. Da die Zusatzversicherungen bleiben würden, würden sowohl das System als auch die Kosten verdoppelt.Ideologische Scheuklappen entfernt Paul Rechsteiner (SP/SG) hielt namens einer Minderheit entgegen, dass «heute die Konkurrenzmöglichkeiten darin liegen, sich gute Risiken abzujagen». Er erhielt von Christine Egerszegi-Obrist (FDP/AG) als einziger bürgerlicher Politikerin Sukkurs: «Damit weicht die Krankenversicherung ihrem eigentlichen Zweck aus, nämlich Menschen im Krankheitsfall zu unterstützen.» Sie forderte ihre Ratskollegen auf, die «ideologischen Scheuklappen» zur Seite legen. Sie erinnerte daran, dass mit dem heutigen System eigentlich «ein echter Wettbewerb gar nicht möglich ist, denn die obligatorische Grundversicherung hat einen definierten Leistungskatalog, und das Angebot sollte für alle dasselbe sein».Kostenmanagement statt Kostenabschiebung Für sie «wäre ein Modell Suva oder ein Modell mit kantonalen oder regionalen Kassen» vorstellbar. «Ein solches Modell brächte ein gutes Kontroll- und Führungssystem sowie Transparenz über die Reserven; der Datenschutz wäre leichter einzuhalten, und Prävention bekäme einen ganz anderen Stellenwert.» Eine Finanzierung aus einer Hand würde aus ihrer Sicht Hunderte von Millionen Franken an Marketing- und Werbekostensparen. «Statt einer Kostenabschiebung wäre endlich ein Kostenmanagement möglich.» Ein solches Modell würde auch Anita Fetz (SP/BS) wählen, «weil ich weiss, dass ich als Versicherte nicht abgezockt werde». SP-Ständerat Hans Stöckli (BE) wagte zu fragen, ob es denn «wirklich 61 Kassen braucht für diesen Dienst an der Bevölkerung».Vor allem bürgerliche Politikerinnen setzten sich für das heutige System mit 61 Krankenversicherern ein. /
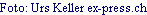 Und er erinnerte daran, dass die Medizin mit einer öffentlichen Krankenkasse nicht verstaatlicht würde. Unbestrittener Handlungsbedarf Die meisten Ständerätinnen und Ständeräte waren sich darüber einig, dass es bei der Aufsicht der Grundversicherer Verbesserungen bedarf. Weit verbreitet bedauerten auch die Bürgerlichen, dass der Nationalrat vergangene Woche beschloss, das entsprechende Gesetz an den Bundesrat zurückweisen zu wollen. Gesundheitsminister Alain Berset betonte, dass der Bundesrat keinen Systemwechsel wolle, sondern gezielte Verbesserungen. Diese lägen allesamt auf dem Tisch. So etwa der verfeinerte Risikoausgleich, welcher der Nationalrat vergangene Woche mit Anpassungen zugunsten der Versicherer angenommen hat, und die Trennung von Grund- und Zusatzversicherung. Angesprochen auf die Finanzierung der Kampagne gegen die Initiative, stellte er einmal mehr klar, dass es illegal sei, Gelder der Grundversicherung dafür zu benutzen. «Wir werden das kontrollieren.» Und er stellte eine Abstimmung im Jahr 2014 in Aussicht, wenn nichts dazwischen komme.Eilzugstempo wegen der Wahlen 2015 Er spielte damit auf das Parlament an, das im Frühjahr in einem beispiellosen Akt den Bundesrat zu einer raschen Behandlung der Initiative ohne Gegenvorschlag drängen wollte, damit die Vorlage nicht im Wahljahr 2015 zur Abstimmung kommt. Berset liess sich die Vernehmlassung zu einem indirekten Gegenvorschlag jedoch nicht nehmen, zog ihn aber nach vernichtenden Stellungnahmen zurück. Als nächstes muss nun der Nationalrat über die Initiative befinden. Die Initiative «Für eine öffentliche Krankenkasse» ist vor eineinhalb Jahren mit gut 115'000 gültigen Unterschriften eingereicht worden. Sie verlangt, dass die soziale Krankenversicherung von einer einheitlichen, nationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung wahrgenommen wird. Verantwortlich sollen Vertreterinnen und Vertreter des Bundes, der Kantone, der Versicherten und der Leistungserbringer sein. Kantonale oder interkantonale Agenturen legen die Prämien fest, ziehen sie ein und vergüten die Leistungen. Für jeden Kanton wird eine einheitliche Prämie festgelegt; diese wird aufgrund der Kosten der sozialen Krankenversicherung berechnet. Die Befürworter der Initiative erhoffen sich von einer Einheitskrankenkasse tiefere Kosten, mehr Transparenz sowie eine bessere Steuerung.
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|