|
Freitag, 8. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Komet MenschheitVor zirka 66 Millionen Jahren erschütterte ein Komet mit ca. 10 Kilometer Umfang, der mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit einschlug, unsere Erde und leitete das fünfte allgemein anerkannte Massenaussterben der Weltgeschichte ein. Wie es aussieht, dürfte das sechste ganz ohne Kometen eintreten - sozusagen hausgemacht.Patrik Etschmayer / Quelle: news.ch / Dienstag, 23. Juni 2015 / 16:24 h
Wobei über die genaue Zahl durchaus gestritten werden kann, da der Begriff Massenaussterben nicht genau definiert ist. Für manche müssen 75% der meisten Arten aussterben, für andere reicht bereits eine grosse Reduktion der Biodiversität, damit das Label «Massenaussterben» verliehen werden kann. Doch eigentlich ist es ja egal, ob es sich um das sechste, siebte oder achte Massenaussterben handelt....
Das erste bekannte (auch wenn es auf den meisten Listen fehlt) fand bereits vor 2,4 Milliarden Jahren statt, als die Cyanobakterien mit der Erfindung der Fotosynthese und der Erzeugung des sehr aggressiven Giftes Sauerstoff in grossen Mengen fast alle anaeroben Bakterien, die bis dahin das Leben auf der Welt stellten, vergifteten. Dann ging es fast 2 Milliarden Jahre bis zum nächsten bekannten Massentod, als vermutlich ein Klimawandel am Ende des Kambriums vor 485 Millionen Jahren 80% aller Lebewesen auslöschte. Nur vierzig Millionen Jahre später, im Ordovizum, starb nochmals die Hälfte des irdischen Lebens aus, wobei nicht klar ist, ob daran eine erdnahe Supernova, oder der Klimawandel durch die damals neuen Landpflanzen daran schuld war. Genau wie das vorherige Sterben war auch jenes im oberen Devon vor 375 - 360 Mio. Jahren ein eher kleineres, aber lange ausgedehntes Massenaussterben, das in mehreren Schüben 'nur' etwa die Hälfte der Fauna und diese ausschliesslich im Meer tötete. Es wird ein Rückgang des Sauerstoffgehalts im Meer vermutet (die Gründe dafür sind aber unklar), das die Evolution der Amphibien und so letzten Endes auch von uns, anschob, weil Tiere, die Luftsauerstoff atmen konnten, einen Vorteil hatten. Dann, vor 252 Millionen Jahren, an der Grenze von Perm und Trias, kam das grösste bekannte Massenaussterben, bei dem innerhalb von 200'000 Jahren 95% aller Meeresbewohner und zwei Drittel aller Landlebewesen verschwanden. Das Sterben fand in drei Phasen statt, wobei die erste (an Land) durch gigantische Vulkanausbrüche in Sibirien und den durch das ausgestossene CO2 verursachten Klimawandel (+5°C) ausgelöst wurde. Die Klimaerwärmung sorgte dann auch für eine Erwärmung der Ozeane, die dazu auch noch versauerten, so dass Meeresorganismen nicht mehr ihre Schalen und Skelette aus Kalk bauen konnten und so ausstarben, selbst wenn sie den Temperaturschock überlebt hätten. In dieser zweiten Phase wurde durch die Erwärmung der Ozeane auch eine grosse Menge des am Meeresboden gebundenen Methans in die Atmosphäre freigesetzt, das als Treibhausgas etwa 20x stärker als CO2 wirkt. Die so entstandene weitere Erwärmung der Atmosphäre um 5°C verursachte an Land eine zweite Welle des Massenaussterbens, das - einzigartig in der Weltgeschichte - sogar ein Drittel der Insekten betraf. Das Ende der Trias, vor 201 Millionen Jahren, sah - vermutlich wieder durch Vulkanausbrüche, die dieses Mal die Atmosphäre mit Schwefeldioxid verseuchten und die flachen Randmeer mit Schwefelwasserstoff vergifteten - ein Massentodereignis, das 50 - 80% aller Tierarten umbrachte. Vor 66 Millionen Jahren kam dann jenes Massenaussterben, das fast jedem ein Begriff ist. Wobei hier - obwohl womöglich sowohl ein Komet als auch ein Supervulkan in Indien daran beteiligt waren - «nur» etwa 50% der Tierarten ausstarben. Fast unbekannt hingegen ist die «Grand Coupure» vor knapp 34 Millionen Jahren, bei der durch eine Klimaabkühlung 60% der Säugetierarten des unteren Oligozäns ausstarben, wobei die Ursachen dieses Klimawandels noch unklar sind - sowohl durch Kontinentaldrift veränderte Meeresströmungen als auch Vulkane und Meteoriteneinschläge werden vermutet. Der obige kurze Abriss macht hoffentlich zweierlei klar: Bei solchen Massenaussterben verschwanden die Arten nicht von heute auf morgen, sondern es handelte sich um Phasen von Tausenden, ja hunderttausenden Jahren, in denen die Tiere aufgrund von veränderten Umweltbedingungen dahingerafft wurden. Andererseits: Die Ursachen des Aussterbens tönen erschreckend bekannt: Klimawandel, Versauerung der Ozeane durch CO2, Vergiftung der Oberflächengewässer, Freisetzung von Methan und Reduktion des Sauerstoffgehalts von Gewässern. Nun ist bei uns kein Komet abgestürzt oder ein Supervulkan ausgebrochen. Doch Arten sterben aus. Das tun sie zwar immer, sonst gäbe es keine Evolution. Doch das Tempo, in dem Arten seit etwas mehr als 100 Jahren aussterben, ist laut einer in Science veröffentlichten Studie im Zeitraum seit 1900 114 Mal höher als normal zu erwarten wäre. Und dies, obwohl die Forscher die Basis-Aussterbensrate 2 bis 20x so hoch ansetzten wie diese allgemein eingeschätzt wird. Trotzdem starben allein unter den Wirbeltieren im letzten Jahrhundert so viele Arten aus, wie sonst in 800-10000 Jahren. Es lohnt sich ganz klar, den frei zugänglichen Aufsatz zu lesen (nur damit einem auch klar wird, warum die Variablen so weit auseinanderliegen und die Ergebnisse vermutlich noch besorgniserregender sind, als sie auf den ersten Blick erscheinen). Massenaussterben früher: Kometeneinschlag. Die Menschheit kann's auch ohne. /
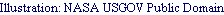 Der - auf sehr vorsichtigen Schätzungen beruhende - Schluss ist der, dass Arten derzeit so schnell wie nicht mehr seit 65 Millionen Jahren, als ein Steinbrocken, der höher als der Mount Everest war, im Golf von Mexiko einschlug, verschwinden. Oder, korrekter gesagt, von uns verschwunden werden. Und wenn es so weiter geht, wird ein weiteres Massenaussterben eintreten, das in seinem Ausmass an jenes der oben ausgeführten heran kommt. Ganz einfach basierend auf dem Verlust von Lebensräumen, Überbelastung aus wirtschaftlichen Gründen, grenzenlosem Konsum und wirtschaftlicher Ungleichheit. Und hier wird es politisch. Denn seit dem Wirtschaftscrash hat die Menschheit offenbar keine Zeit und Musse mehr für solche Kinkerlitzchen wie Umweltschutz und nachhaltiges Wirtschaften. Wir kämpfen mit ökonomischen Desastern auf der ganzen Welt, die Unruhen, Kriege und Flüchtlingsströme auslösen. Doch die Ursachen vieler dieser Unruhen haben auch ökologische Ursachen. Missernten und höhere Getreidepreise verursachen Unruhen und Aufstände in ärmeren Weltgegenden. Und nicht wenige «Wirtschaftsflüchtlinge» sind einfach auf der Flucht vor Hunger und dem Verlust ihrer Lebensgrundlagen. Wobei diese Dürren und Missernten durch bis vor wenigen Jahren unbekannten Extremwetterereignisse ausgelöst werden, die ihre Grundlage im Klimawandel haben, der immer noch von vielen Dummköpfen wortreich, aber faktenarm bestritten wird. Im Hintergrund sterben unterdessen Tierarten aus, einzigartige Spezialisten, hervorgebracht von der Evolution, um spezielle Nischen zu besetzen. Wenn deren Lebensräume weg fallen, verschwinden auch sie. Und dann wird das Eintreten, was auch bei den Massenaussterben der Weltgeschichte schon stimmte: übrig bleiben die «Unkraut-Arten», jene Tiere, die sich überall irgendwie durch schlagen können. Ratten, Mäuse, Heuschrecken und Schaben, um nur mal die prominentesten zu nennen. Opportunistische Arten, Generalisten, die überall durchkommen, auch wenn die Lebensgrundlage dünn geworden ist. Biodiversität schützt unsere Art zu leben und hält opportunistische Tierarten in Schach. Biodiversität birgt auch das Potential von vielen Problemlösungen für uns, die im Erbgut von Tieren und Pflanzen (die auch vom Aussterben betroffen sind) verborgen liegen. Biodiversität sorgt für eine reichhaltigere, lebenswertere Welt, die auch Naturkatastrophen besser wegstecken kann. Es liegt an den von uns bestimmten Politikern für dieses Leben gegen den Gewinn- und Ideologie-gesteuerten Massentod zu kämpfen, denn ob Mexikanische Grizzlys, Tasmanischer Tiger, Karibische Mönchsrobbe, Dodo, Wandertaube, Moa, Quagga, Sardinischer Pika, Steller'sche Seekuh, Auerochs und wie die erst durch den Menschen ausgerotteten Tiere alle heissen, sie wären nur der Anfang einer fast nicht enden wollenden Liste. Es liegt an uns, zu entscheiden, ob wir als eine Naturkatastrophe, als der «Komet Mensch», in die Geschichte eingehen wollen. Die Möglichkeiten durch Technik und Wissenschaft hätten wir. Es fehlen lediglich Einsicht und politischer Wille. Übrigens: Nach einem Massenaussterben erholen sich Flora und Fauna jeweils wieder und erreichen irgendwann wieder dieselbe Vielfalt und denselben Reichtum, die sie vorher hatten. Man muss nur 5 bis 10 Millionen Jahre warten können. Links zum Artikel:
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|