|
Freitag, 22. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Homo homini homoDie landeskirchlich institutionalisierte «Spezialseelsorge» kämpft um interne und externe Legitimität. Mittelfristig wird mit der «Spezialseelsorge» dasselbe passieren, wie schon mit der Krankenpflege: soweit als Service public anerkannt, wird sie säkularisiert werden.Reta Caspar / Quelle: news.ch / Donnerstag, 17. September 2015 / 07:58 h
An der Jahresversammlung der Vereinigung der deutschschweizerischen evangelischen Spitalseelsorgerinnen und -seelsorger sprach letzte Woche Christa Anbeek, Professorin für Systematische Theologie an der Freien Universität Amsterdam und zuständig für die praktische Ausbildung von «humanistischen Seelsorgern» an der humanistischen Fakultät in Utrecht, welche Konfessionslose in Heimen und Kliniken begleiten. Anbeek kritisiert, dass die Seelsorgeausbildung der Humanisten ohne jegliche Theologie auskomme und sich ganz in der medizinisch-psychologischen Logik bewege. Sie plädiert für den Mehrwert einer religiösen Orientierung und entwickelte ein Curriculum, das auf den klassischen «theologischen Loci» aufbaut und diese fruchtbar machen will für die seelsorgerliche Praxis.
Das Curriculum selbst wurde von den rund 80 anwesenden Vereinsmitgliedern und auch von der Schreibenden durchaus positiv aufgenommen. Dies allerdings wohl genau deshalb, weil sie darin die religiöse Sprache und die religiösen Antworten aufgibt und einen Fragenkatalog entwickelt, den jede praktische Philosophin und jeder Psychologe übernehmen könnte.
Die mehrfache Abwertung der «rein psycho-sozialen» und Palliativ-Angebote der Spitäler durch die Referentin hingegen stiess zum Teil auf deutliche Widerspruch. Die PraktikerInnen wissen, dass hier längst eine Konvergenz der medizinischen mit den religiösen und psychosozialen Fragen stattfindet. Und auch der neuere Begriff «Spiritual Care» ändert nichts daran: Um menschliche Fragen geht es in erster Linie in jenen Momenten im Leben, an denen die gewohnte Sicht auf mich, meine Beziehungen und meine Prioritäten erschüttert werden. Eine einfühlsame Seelsorge tut nichts, was ein praktischer Philosoph oder eine Psychologin nicht tun würde: Durch Anteilnahme und Fragen jenen gedanklichen Prozess unterstützen, der zur notwendigen Neuorientierung führen soll. Die von Anbeek postulierte Sinnfrage hingegen, die einen übergeordneten Sinnzusammenhang voraussetzt, kann für nicht religiös sozialisierte Menschen kein Mehrwert sein.
Anbeeks Curriculum mutet denn auch mehr als ein Versuch an, die Terminologie der systematischen Theologie in die in der Praxis kaum noch theologisch ausgerichtete Spezialseelsorge der Kirchen zu übersetzen. Oder umgekehrt, die faktisch längst säkularisierte Spezialseelsorge intern theologisch legitimieren, gemäss dem Befund von Prof.
Haus der Religionen: Sollte Haus der Menschen heissen. Genau wie die Seelsorge «Menschensorge» sein sollte. /
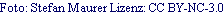 Christoph Morgenthaler, Institut für Praktische Theologie an der Universität Bern (Zoom 2011/3): «Spitalseelsorgerinnen und -seelsorger entwickeln als kirchliche 'Vorposten' in einem säkularen Umfeld eine religiöse Sprache, wie sie Menschen heute brauchen: verständlich, bedürfnisorientiert, inspirierend, kritisch, spirituell. Sie zeigen, wie Kirchen insgesamt menschenfreundlicher und seelsorglicher werden können.» Bezahlt werden die Spezialseelsorger in der Schweiz übrigens mehrheitlich von den «Landeskirchen», aber die öffentliche Hand gibt Zuschüsse bis zu einem Drittel des Budgets oder rechtfertigt allgemeine Transferzahlungen mit diesem «Service public» der «Landeskirchen». In Gesprächen mit verschiedenen TeilnehmerInnen verstärkte sich der Eindruck, dass die Praxis weit entfernt ist, von den theologischen Debatten. Spitalseelsorgende sind jene Personen im hektischen Spitalbetrieb, die einfach da sind, die einfach Zeit haben für ein Gespräch, die an keinen genau definierten Zeitplan gebunden sind und keine umfangreichen administrative Rechtfertigung ihrer Arbeit abliefern müssen. Auch aus der Gefängnisseelsorge ist bekannt, dass Häftlinge den Seelsorger vor allem deshalb sprechen wollen, weil er ihnen einen menschlichen Kontakt und eine willkommene Abwechslung bietet und kaum wegen seiner religiösen Ausrichtung oder theologischen Qualifikation. Das ist unbestritten eine Qualität im Alltag solcher Institutionen. Mittelfristig wird mit der «Spezialseelsorge» jedoch dasselbe passieren müssen, wie schon mit der Krankenpflege: soweit als wichtiger Service public anerkannt, wird sie säkularisiert werden. In einer säkularisierten Schweiz, in der weit mehr als die Hälfte der Menschen sich von der organisierten Theologie distanzieren, wird jedoch nicht mehr wie heute ein abgeschlossenes Theologiestudium als primäre Voraussetzung gefordert werden können. Die Tagung fand übrigens im Berner «Haus der Religionen - Dialog der Kulturen» statt. Auch dort ein ähnlicher Eindruck: Es sollte eigentlich «Haus der Menschen» heissen, nicht der «Haus der Religionen». Denn es kommen Menschen dort hin, die Menschen begegnen wollen: die gemeinsame Muttersprache und das gemeinsame Essen vertrauter Speisen aus der Herkunftskultur sind wesentlich. Deshalb gibt es ja auch immer noch eine «Swiss Church» in London, da wollen die Menschen Deutsch sprechen und sich mit anderen Expats treffen. Das eigentlich Religiöse - sofern es das ausserhalb des Menschlichen überhaupt gibt - steht nur für eine kleine Minderheit im Zentrum. Homo homini homo - Häuser für die Begegnung von Menschen und «Menschensorge in schwierigen Lebenssituationen» - nur unter diesem Label jedenfalls sollten solche Angebote im säkularen Staat auch staatlich finanziert werden.
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|