|
Dienstag, 26. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Multi-Reli im IntegrationspelzEine Koalition von «Landeskirchen», Sozialdemokraten und Grünen hat einem 10 Millionen teuren Prestigebau in Bern zum Durchbruch verholfen. Die Berner SteuerzahlerInnen werden den Schaden haben - das Projekt hat die öffentliche Hand schon mehrere Millionen gekostet und wird das Budget noch über Jahre belasten.Reta Caspar / Quelle: news.ch / Donnerstag, 11. Dezember 2014 / 08:26 h
Das Kantonsparlament sprach 2.2 Millionen aus dem Lotteriefonds für den Bau des «Dialogbereichs», der rund 40 Prozent des «Hauses der Religionen» ausmachen soll, - das sind 60 Prozent der Kosten, bedeutend mehr als die üblichen 40 Prozent, die der Fonds normalerweise übernimmt. Die Begründung: Empfehlungen von Kirchen und der theologischen Fakultät der Uni Bern.
Die Politik hat 3,25 Millionen Franken für die Gestaltung und Beleuchtung der Umgebung abgesegnet, ebenso den Verzicht auf Teile des Baurechtszinses (insgesamt ca. 120'000 Franken pro Jahr für die ganze Liegenschaft) und auf Mehrwertabschöpfung aus der höheren Auslastung des Grundstücks (2,2 Millionen Franken) sowie dem Volk mit dem Budget 2015-2018 je weitere 200'000 Franken pro Jahr für die Betriebskosten des Projekts untergejubelt.
Einspannen liessen sich für dieses Berner Denkmal - eines seit 20 Jahren bemühten, aber zahlenmässig unbedeutenden interreligiösen Dialogs - der ehemalige Stadtpräsident Klaus Baumgartner (SP), die ehemalige Regierungsstatthalterin Regula Mader (SP), die ehemalige Stadt-Berner Integrationsministerin Edith Olibet (SP) und der ehemalige Berner Kultursekretär Christoph Reichenau (GFL).
Beim Versuch, auch Bundesgelder anzuzapfen, ist diese prominente Lobby 2013 vor dem Bundesverwaltungsgericht gescheitert. Es befand, dass das Bundesamt für Kultur das Beitragsgesuch zu Recht abgelehnt hatte, weil das Projekt kein künstlerisches Produkt sei und keine nationale Bedeutung habe.
Die Berner Reformierten haben einerseits 52'000 Franken in den «christlichen Raum» im «Haus der Religionen» investiert und andererseits in die offenbar reichlich gefüllte Schatulle gegriffen und ein unverzinsliches Darlehen von 1 Mio. Franken gewährt. Die selben Reformierten, deren Pfarrlöhne immer noch aus allgemeinen Steuermitteln bezahlt werden, und die unter den Sparbemühungen des kantonalen Parlamentes so sehr ächzen, dass sie dieses Jahr sogar auf die Strasse gingen, haben kürzlich auch locker mal ihren Beitrag an die jährlichen Betriebskosten des Prestigeprojekts von 60'000 auf 100'000 Franken erhöht, mit der Begründung, man könne sich jetzt nicht zurückziehen angesichts des jährlichen Budgets von mittlerweile über 1 Million Franken (500 Stellenprozente): «ein Scheitern oder Verkümmern dieses einmaligen Projekts wäre eine peinliche Vorstellung aller involvierten Religionsgemeinschaften in der Öffentlichkeit.»
Die weit weniger zahlreichen Berner Katholiken, auch sie hängen am Lohntropf aus allgemeinen Steuermitteln, haben mit einem zinsloses Darlehen von 1 Mio. Franken gleichgezogen .
Die Jüdische Gemeinde Bern, auch ihr Rabbi wird aus allgemeinen Steuern bezahlt, stellt ein Mitglied im Vorstand, aber hat keine finanziellen Verpflichtungen übernommen. Die Christkatholiken, ebenfalls steuerfinanzierte Berner «Landeskirche», unterstützen das Projekt finanziell auch nicht.
Die Achse der Berner Staatsreligionen, die alle auch von den umstrittenen Kirchensteuern juristischer Personen profitieren, hat den Grundstein zu diesem religiösen Denkmal gesetzt, mit dem Ziel, die Verflechtungen zwischen Staat und Religionen zu stärken und den Mythos der eigenen Unverzichtbarkeit trotz schwindender Mitgliederzahlen durch Multi-Reli zu festigen.
Der ursprüngliche Name des Projekts war «Haus der Religionen». Es ging darum, verschiedenen Weltreligionen repräsentative Gebetsräume unter einem Dach anzubieten.
Haus der Religionen: Prestigeprojekt mit dem Ziel die Verflechtung von Staat und Religion zu stärken. /
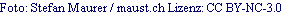 Davon profitieren heute Vereine der «alevitischen, christlichen, islamischen, buddhistischen und hinduistischen Glaubenstradition». Wie viele Mitglieder diese Vereine zählen, ist unbekannt. 2008 hat sich der islamische Kantonalverband Bern (Umma) aus dem Trägerverein zurückgezogen, verblieben ist lediglich der Berner «Muslimische Verein» mit Mitgliedern aus dem Balkan. Der vorhandene Raum ist nun verteilt - was wenn eine weitere «Tradition» hinzukommen möchte? Wird dann auf Kosten der SteuerzahlerInnen ausgebaut? Später und offensichtlich unter Marketingüberlegungen dazu gekommen ist der Beiname «Dialog der Kulturen». Auf der Webseite steht zu lesen, woraus dieser Dialog bestehen soll: aus dem friedlich neben einander Leben, miteinander essen und in den Eingangshallen aneinander vorbei gehen. Typischerweise hat jede «Tradition» aber ihren eigen Küchenbereich, denn am liebsten kochen die Kulturen für sich, das Essen unter seinesgleichen und Plaudern in der Muttersprache gehört wohl zu den von Migranten am häufigsten gesuchten Aktivitäten. Die religiöse Praxis wird mehrheitlich als Tradition wahrgenommen, wie in der gesamten Schweizer Bevölkerung auch. Mit Dialog der Kulturen und mit Integration hat das alles sehr wenig zu tun. Atheisten sollen übrigens laut Prospekt im «Haus der Religionen» auch willkommen sein, allerdings wird sich wohl kaum eine Atheistin vom derzeitigen Programm angezogen fühlen: auch nicht von einem Film wie «Kramer versus Kramer», der dann natürlich nicht interreligiös diskutiert - dafür gibt er schlicht nichts her - sondern von einer Psychologin gedeutet wird. Trotzdem wird die Trägerschaft nichts unversucht lassen, wo nicht unter dem Titel «Kulturförderung» was zu holen ist, wenigstens unter dem Titel «Integrationsförderung» weitere Subventionen abzuholen. Vermutlich mit Erfolg, weil auch dort Parteigenossen an entscheidender Stelle sitzen, die in dieser Frage Tomaten auf den Augen haben und denen «Multi-Reli» als Integration gilt. Die Stadt Bern hat mit der Verleihung des «Integrationspreises der Stadt Bern für das Jahr 2006» bereits vorgelegt. Denk mal, statt Denkmal Es spricht vieles dafür, dass Integration nicht durch, sondern bestenfalls trotz Religiosität gelingt. Wer sich seiner Religion widmet - ob aus schweizerischer oder anderer Tradition - tut das aus Eigeninteresse; das ist legitim, aber es soll nicht durch öffentlich Gelder gefördert werden.
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|