|
Mittwoch, 21. Mai 2025 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Nationalrat gegen Umsetzung der AlpenkonventionBern - Der Nationalrat lehnt die Umsetzung der Alpenkonvention ab. Neun Umsetzungsprotokolle des Abkommens zum Schutz des Alpengebiets sind am Widerstand der bürgerlichen Parteien gescheitert. Diese kritisierten, dass die Alpenkonvention die Wirtschaft zu wenig berücksichtige.zel / Quelle: sda / Freitag, 11. Dezember 2009 / 10:09 h
Der Alpenschutz werde zu einseitig in den Vordergrund gerückt, sagte Kommissionssprecher Toni Brunner (SVP/SG). Problematisch sei auch die völkerrechtliche Verbindlichkeit. Die Strategie der Schweiz zur Entwicklung des Alpengebiets müsse Vorrang haben. Der Nationalrat lehnte Eintreten auf die Vorlage mit 97 zu 94 Stimmen ab. Diese geht nun zurück an den Ständerat.
Die kleine Kammer hatte 2004 nur drei Protokollen zugestimmt, nämlich jenen zu Verkehr, Bodenschutz sowie Raumplanung und nachhaltige Entwicklung.
Der Alpenschutz werde zu einseitig in den Vordergrund gerückt, sagte Kommissionssprecher Toni Brunner (SVP/SG). (Symbolbild) /
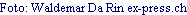 Jene zu den Themen Berglandschaft, Naturschutz und Landschaftspflege, Bergwald, Tourismus, Energie und Streitbeilegung lehnte der Ständerat ab. Berichtforderung vom Bundesrat Gleichzeitig beauftragten beide Kammern den Bundesrat, einen Bericht zu den Auswirkungen aller Protokolle auf das Landesrecht und das Berggebiet zu verfassen. Die Alpenkonvention ist ein Übereinkommen zwischen den Alpenstaaten Österreich, Deutschland, Liechtenstein, Frankreich, Slowenien, Monaco, der Schweiz, Italien und der EU. Ab Beginn der 1990er-Jahre arbeiteten diese Staaten eine Rahmenkonvention aus, die im März 1995 in Kraft trat. Die Schweiz ratifizierte die Rahmenkonvention 1999. Hingegen wurde die Ratifizierung der bis damals abgeschlossenen Durchführungsprotokolle vom Parlament zurückgestellt mit dem Auftrag, erst alle Protokolle auszuhandeln. Diese Arbeiten wurden im Jahr 2000 abgeschlossen.
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|