|
Freitag, 8. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
«Cassis-de-Dijon-Prinzip» wird in Kraft gesetztBern - Geht es nach den Wünschen von Bundesrat und Parlament, kommen ab Anfang Juli die Preise für Import-Produkte aus EU- und EWR-Ländern unter Druck. Der Bundesrat hat beschlossen, das Bundesgesetz über technische Handelshemmnisse und damit das «Cassis-de-Dijon-Prinzip» in Kraft zu setzen.ade / Quelle: sda / Mittwoch, 19. Mai 2010 / 10:27 h
Fortan sollen somit Produkte, die in der EU beziehungsweise im EWR rechtmässig in Verkehr gesetzt wurden, auch in der Schweiz ohne zusätzliche Kontrollen vertrieben werden dürfen. Bislang unterschiedliche Anforderungen etwa an die Produktesicherheit oder an die Produkteinformation sollen so künftig in der Regel den Verkauf dieser Produkte in der Schweiz nicht mehr verunmöglichen.
Wer ein in der EU zugelassenes Produkt in der Schweiz verkaufen will, muss so zum Beispiel die Produkteinformationen nicht mehr in drei Landessprachen aufführen - eine reicht. Von der neuen Regeln die ab 1. Juli gelten, dürften insbesondere Kosmetika, Textilien und Möbel profitieren.
Belebung des Wettbewerbs Regierung und Parlament versprechen sich von der autonomen Übernahme des «Cassis-de-Dijon-Prinzips» eine Belebung des Wettbewerbs. Dank sinkender Importpreise soll so die Hochpreisinsel Schweiz unter Druck geraten.Der Bundesrat setzt die Produktesicherheit wie in der EU in Kraft. /
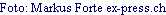 Der Bundesrat rechnet damit, dass sich die Importe um rund 2 Milliarden Franken verbilligen. Verschiedene Ökonomen stellen hinter diese Zahlen ein Fragezeichen. Gemäss einer Studie der Credit Suisse etwa, sind dem «Cassis-de-Dijon-Prinzip» wegen der zahlreichen Ausnahmen die Zähne gezogen worden. Grundsätzlich sind Ausnahmen nur zum Schutz überwiegender öffentlicher Interessen möglich. Welche Produkte nach diesem Prinzip geschützt werden sollen, war umstritten. Zu den Ausnahmen gehören etwa 60 Produktegruppen. Sie sind auf Negativlisten aufgeführt. Produkte mit Zulassungspflichten 20 davon betreffen Produkte mit Zulassungspflichten - etwa für Medikamente. 20 weitere sind auf Produkteverbote zurückzuführen - etwa das Verbot von Phosphat in Waschmitteln. Eine letzte Gruppe von Ausnahmen geht auf einen Bundesratsentscheid vom Oktober 2007 zurück. Die Regierung hatte damals 18 von 128 Ausnahmeanträgen zugestimmt, die die Antragssteller mit höheren Standards der Schweiz im Gesundheits-, Umwelt-, Konsumenten- und Tierschutz begründeten.
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|