|
Mittwoch, 27. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Kommission fordert 24 Wochen Elternzeit für junge FamilienBern - Nach der Geburt eines Kindes sollen sich Eltern während insgesamt 24 Wochen Zeit für die Familie nehmen können. Mit dem Modell «Elterngeld und Elternzeit» will die Eidg. Koordinationskommission für Familienfragen (EKFF) die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern.fest / Quelle: sda / Dienstag, 26. Oktober 2010 / 20:37 h
Heute erhalten erwerbstätige Frauen nach der Geburt ihres Kindes 14 Wochen eine Mutterschaftsentschädigung. Die Väter dürfen sich je nach Gutdünken des Arbeitgebers einen oder mehrere Tage frei nehmen. «Mit dieser Regelung werden junge Familien nicht genügend entlastet», sagte EKFF-Präsident Jürg Krummenacher am Dienstag vor den Medien in Bern.
Die Kommission will folgendes Modell im Gesetz verankern: Mütter und Väter dürfen sich nach einer Geburt maximal 24 Wochen Zeit für ihre Familie nehmen. Die Bezugsdauer kann beliebig aufgeteilt werden. Vier Wochen sind allerdings für die Väter reserviert - ansonsten verfallen sie. «Diese Regel ist wichtig, um die Väter zur Beteiligung zu animieren», erklärte Krummenacher.
Fast neun Monate beim Kind
Die Elternzeit ist als Ergänzung zur bestehenden Mutterschaftsentschädigung gedacht.
Das Geld sei gut investiert. /
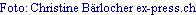 Eine Mutter könnte so bis zu achteinhalb Monate zu Hause bleiben. Ein Vater maximal fünf Monate. Ansonsten will die EKFF nicht vorschreiben, wie die Elternzeit eingezogen werden soll: Die Bezugsperiode dauert von der Geburt bis zur Einschulung. Möglich sei es auch, die Zeit in Teilabschnitten oder als Teilzeiterwerbstätigkeit zu beziehen. Entschädigt werden die Eltern mit 80 Prozent des Bruttolohnes oder maximal 196 Franken pro Tag. Über eine Milliarde Franken im Jahr Die EKFF rechnet mit Kosten von 1,1 bis 1,2 Milliarden Franken pro Jahr. Zur Finanzierung will die Kommission entweder die Erwerbsersatzbeiträge oder die Mehrwertsteuer erhöhen. Bei der Finanzierung über die Erbwersersatzordnung müssten bei Arbeitgebern und -nehmern je 0,2 Prozent mehr abgezogen werden. «Dafür müsste durchschnittlich jede Person zweimal im Monat auf einen Milchkaffee verzichten», rechnete der EKFF-Präsident vor. Die Mehrwertsteuer müsste um 0,4 bis 0,5 Prozent angehoben werden. Das Geld sei gut investiert, ist die EKFF überzeugt: Einerseits profitiere jede Familie von «optimalen Startbedingungen»; andererseits stärke die Schweiz mit einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf die Wirtschaft. Denn diese sei auf gut ausgebildete Frauen wie auch auf hochqualifizierte ausländische Arbeitskräfte angewiesen.
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|