|
Freitag, 8. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Ablehnung der SP-Steuerinitiative mit 58,5 ProzentBern - In der Schweiz wird kein einheitlicher Mindeststeuersatz für hohe Einkommen und Vermögen eingeführt. Volk und Stände haben die Steuergerechtigkeitsinitiative der SP abgelehnt. 58,5 Prozent der Stimmenden legten ein Nein in die Urne.fest / Quelle: sda / Sonntag, 28. November 2010 / 15:30 h
Rund 1,07 Millionen Stimmende teilten die Ansicht der Initianten, dass der Steuerwettbewerb eingedämmt werden sollte. 1,51 Millionen Stimmende folgten dagegen dem Bundesrat, den bürgerlichen Parteien und den Wirtschaftsverbänden, welche die Initiative bekämpft hatten.
Am deutlichsten abgelehnt wurde die Initiative in den Kantonen mit den niedrigsten Steuersätzen für Reiche. In Zug, Nidwalden und Obwalden sagten fast 80 Prozent der Stimmenden Nein zur Initiative. Im Kanton Schwyz lag der Nein-Stimmen-Anteil bei 78 Prozent, im Kanton Appenzell Innerrhoden bei 75 Prozent und im Kanton Uri bei 71 Prozent.
Vier Kantone sagen Ja
Mit Ausnahme von Basel-Stadt lehnten alle Deutschschweizer Kantone die Initiative ab; Basel-Stadt stimmte ihr mit 59 Prozent zu.
Genf sagte Ja zur Steuergerechtigkeitsinitiative. /
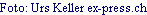 In der Westschweiz wurde die Initiative in drei Kantonen angenommen: Im Kanton Jura sagten 59 Prozent der Stimmenden Ja, im Kanton Neuenburg 57 Prozent und im Kanton Genf 51 Prozent. Am knappsten war die Ablehnung in der Deutschschweiz im Kanton Bern, wo 52 Prozent der Stimmenden Nein sagten. Zwischen 50 und 60 Prozent lag der Nein-Stimmenanteil in den Kantonen Zürich, Basel-Landschaft, Glarus, Schaffhausen, Solothurn, Waadt, Freiburg und Tessin, zwischen 60 und 70 Prozent in den Kantonen Wallis, Graubünden, Aargau, Thurgau, St. Gallen, Luzern und Appenzell Ausserrhoden. Auswüchse des Steuerwettbewerbs eindämmen Die SP hatte mit der Initiative das Geschacher der Kantone um die Reichsten eindämmen wollen. Im Visier hatten die Initianten das reichste Prozent der Bevölkerung: Es ging um Einkommen von mehr als 250'000 und Vermögen von über 2 Millionen Franken. Die Initiative verlangte, dass diese durch Kanton und Gemeinde mit einem Steuersatz von mindestens 22 Prozent beziehungsweise 5 Promille belastet werden. Viele Kantone erfüllen diese Vorgaben heute nicht. Bei einem Ja hätten 16 Stände die kantonalen und/oder kommunalen Steuersätze für die Reichsten erhöhen müssen.
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|