|
Dienstag, 5. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Killerspiele können Schmerzen lindernKeele/Wien - Gewalttätige Videospiele können die Toleranz für Schmerzen erhöhen.fest / Quelle: pte / Montag, 10. September 2012 / 18:37 h
Zu diesem Schluss kommen Forscher der britischen Keele University, die 40 Testpersonen unterschiedlichen virtuellen Reizen ausgesetzt und dabei ihre Schmerzempfindlichkeit beobachtet haben. Die grosse Überraschung: Spieler von gewaltfreien Spielen sind empfindlicher als Spieler von Ego-Shootern.
65 Prozent länger ausgehalten
«Wir sind davon ausgegangen, dass emotionale Reaktionen eine deutliche Auswirkung auf das Schmerzempfinden von Menschen haben. Bei diesem Test haben wir die Probanden in einen aggressiven Zustand versetzt und dabei die Auswirkungen beobachtet. Das Resultat bestätigt unsere Annahmen, dass gewalttätige Videospiele die Schmerzgrenze erhöhen», erklärt Forschungsleiter Richard Stephens.
Die untersuchten Personen spielten abwechselnd Killer- und gewaltfreie Spiele. Danach steckten sie ihre Hände in Eiswasser. Durchschnittlich liessen jene Personen, die mit gewalttätigen Inhalten konfrontiert wurden, ihre Hände 65 Prozent länger im Eiswasser.
Beim Spielen von Gewaltspielen wie z.B. «Call Of Duty» wird die körpereigene Schmerzabwehr aktiviert. /
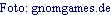 Das Forscherteam sorgte schon vor einem Jahr für Schlagzeilen als es die Theorie aufstellte, dass Fluchen die Schmerzempfindlichkeit senkt. Gehirnforscher übt Kritik «Ich halte diese Studie für sehr plakativ. Sie ist wissenschaftlich nicht bahnbrechend. Jede Form von akutem Stress kann eine ähnliche Reaktion auslösen. Diese körpereigene Schmerzabwehr ist ein sehr sinnvoller Mechanismus. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man diese Körperreaktion für eine Therapie einsetzen kann, weil es dabei zu einer Abschwächung der Reizbeantwortung kommt», sagt Jürgen Sandkühler vom Zentrum für Hirnforschung in Wien im Interview. Die britischen Forscher trotzen der Kritik und sehen für ihre Entdeckung viele Anwendungsmöglichkeiten. «Schmerzforscher untersuchen schon lange, wie man virtuelle Realität für die Therapie einsetzen könnte. Eine Gruppe von Wissenschaftlern in Seattle verwendet eine ähnliche Methode, um Kinder mit schweren Verbrennungen das Leben zu erleichtern», so Stephens. Die Studie wurde in der letzten Ausgabe des Branchen-Journals «Psychological Reports» veröffentlicht.
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|