|
Montag, 4. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Die Schweiz sucht ihren nächsten SuperbundesratDank der Mediendemokratie sind wir uns ja mittlerweile schon einiges punkto Fassadenpolitik gewohnt. Doch dass die SVP nun allen Ernstes eine Castingshow für Regierungsmitglieder vorschlägt, toppt die Tragödie als Farce. Sie haben richtig erraten: Es geht um die Initiative «Volkswahl des Bundesrates».Regula Stämpfli / Quelle: news.ch / Montag, 13. Mai 2013 / 11:22 h
Allein das Argument, «das Volk solle mehr Rechte bekommen» kann nur als zynisch bezeichnet werden. Wer meint, in einer herrschenden politischen Kultur, welche sich im Wesentlichen um die Diskussion von Umfragewerten und die Copypaste-Qualität einer Politikerin kümmert, dem «Volk» durch eine Direktwahl der Regierung mehr Rechte zu geben, ist entweder Zyniker oder Satiriker. Das Volk kriegt durch die Direktwahl des Bundesrates nicht mehr Rechte - dies würde es wohl eher kriegen, wenn es über finanzpolitische Entscheide von Tragweite wie die Rettung der Swissair oder der UBS entscheiden könnte, aber davon will selbst die SVP nichts wissen.
Fairerweise könnte man aber auch einwerfen: «Ach, die Demokratie Schweiz ist eh eine Farce, weshalb diese also mit einer Castingshow für die Regierung nicht an die Spitze treiben?» - doch das wäre echt arg zynisch und entspräche nicht der Grundhaltung einer Demokratin. Klar doch: Die Aushöhlung der verfassungsrechtlichen Grundlagen, welche im 19. Jahrhundert das Versprechen der Demokratie zu verwirklichen suchten, ist auch ohne Volkswahl des Bundesrates weit fortgeschritten. Die «marktkonforme Demokratie», wie sie Angela Merkel bezeichnet, ist hierzulande schon längst zur «bankkonformen Demokratie» mutiert.
Der «autonome Nachvollzug» ist die Rosinenpickervariante eines EU-Beitritts ohne Nettozahlung - wohl nicht zuletzt auch möglich wegen der vielen «Hoeness» in Brüssel, die Teufel tun würden, die Schweiz als Steuerfluchtland par excellence auszutrocknen.Kurz: Um die Demokratie steht es in Zeiten der herrschenden Kapitalismusreligion nicht zum Besten. Doch andererseits wäre es wirklich der Gipfel an nihilistischer Zerstörungslust, die - immerhin in einigen Punkten noch einigermassen funktionierende Demokratie - endgültig dem voraufklärerischen Zustand preiszugeben.
Der schweizerische Bundesrat hat es durch sein ausgeklügeltes System der Balance zwischen Sprachen, Regionen und Parteien immer wieder geschafft, eine genuin schweizerische Politik zwischen Anpassung und Eigenständigkeit zu betreiben, die den Kleinstaat stabil gehalten hat. Wenn wir in den Kanton Neuenburg blicken, wo sich jahrelang unversöhnliche und direkt gewählte Regierungsmitglieder so stark bekämpft haben, dass sie den Kanton fast ruiniert haben, dann sollten wir realisieren, dass eine direkt gewählte nationale Regierungszusammensetzung für das Volk nicht mehr Rechte, sondern vor allem mehr Probleme mit sich bringen würde.
Zudem: Wer würde von der Volkswahl der Bundesräte am meisten profitieren? Neben allen Medien, die plötzlich ungleich mehr Geld durch die politischen Wahlkämpfe in die Kassen fliessen sähen, wären die eigentlichen Sieger solcher Volkswahlen vor allem die Verwaltungsbeamten. Professionell, gut bezahlt, mit sicherem Posten ausgestattet, würde es ihnen noch mehr als jetzt keine Rolle mehr spielen, wer unter ihnen als Bundesrat gewählt würde.
Bundesrat: politischen Geschicke nicht von Populisten, sondern von Mehrheitsmenschen gestalten lassen. /
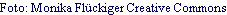 Die Macht der Verwaltung zu stärken, kann aber selbst der SVP kein politisches Anliegen sein. Wohl deshalb zeigt sich die SVP-Anhängerschaft punkto Volkswahl Bundesrat unterdessen reservierter als gleich nach der Abwahl ihres Alphatieres Christof Blocher. Es gibt zudem ein Argument, welches die nach heutigem System gewählten Bundesräte volksverbundener macht als solche, die vom Volk direkt ernannt würden. Jedes Regierungsmitglied hat bisher das Amt mit einem strengen, lehrreichen und der politischen Kultur des Landes entsprechende Ochsentour durch Gemeinden, Kantone und Parteien absolviert. Solche Qualitäten sind wichtig für ein Regierungsamt. Denken wir an Ruth Metzler, die genau aufgrund dieser fehlenden persönlichen und politischen Vernetzung nur ein kurzes Intermezzo im Bundesrat absolvieren durfte. Und die Amtszeit von Christof Blocher war das beste Argument gegen die Volkswahl des Bundesrates, denn der Populist Blocher in der Schweizer Regierung brachte das Land gefährlich nah an innere Zersetzung und äusseren international irreparablen Imageschaden. In einem vielsprachigen Vielparteienland können die politischen Geschicke nicht von Populisten, sondern müssen von Mehrheitsmenschen mitgestaltet werden. Zudem bringt ein vom Parlament gewählter Bundesrat meist auch lang eingeübte charakterliche Stabilitäten mit: Ein Choleriker in der Regierung ist zwar für die Medien ein Geschenk, für lösungsorientierte Politik aber eher hinderlich. Und dass gute Mediensprecher noch längst keine guten Politikerinnen abgeben, wissen wir nun dank aktuellen Beispielen hinlänglich. Die Direktwahl des Bundesrates würde in der Schweiz endgültig die Amerikanisierung hiesiger Verhältnisse bringen. Das Parlament würde auf seine Rolle des zerstrittenen Haufens noch mehr reduziert als es dies durch die direkte Demokratie eh schon ist, die Regierungsmitglieder wären noch weniger kollegial Politisierende, sondern Einzelkämpfer und die Abhängigkeit der Bundesräte von den Mainstreammedien und Verbänden wie Lobbyisten noch stärker als eh schon. Ja, selbstverständlich: Das bisherige Wahlsystem der Bundesräte hat seine Schattenseiten. So ist klar, dass es in der Schweiz - mit Ausnahme wohl von Alain Berset - the «best and the brightest» nie an die Spitze des Landes schaffen werden. Trotzdem: Es wäre äusserst ungeschickt, in einer Zeit, die durch einen eigentlichen Politik-und Demokratieverlust geprägt ist, ausgerechnet die Institution, die bisher dem weitreichenden Populismus noch einigermassen Widerstand geleistet hat, vollends der Beliebigkeit der Meinungs- und Umfragedemokratie zu opfern. Schliesslich hoffen wir ja alle, dass endlich der Spuk der Castingshows sowohl für Politik als auch Wissenschafts- und Arbeitswelt endlich mal ein Ende haben wird, oder?
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|