|
Sonntag, 3. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Mein Weg zu mehr Lebensqualität und weniger WelthungerEs gibt kaum ein Problem, bei dem wir Konsumenten so viel mit so einfachen Massnahmen erreichen können, wie im Bereich der Lebensmittelverschwendung.Claudio Beretta / Quelle: ETH-Zukunftsblog / Dienstag, 25. Juni 2013 / 08:45 h
Wenn wir bewusster mit unseren Lebensmitteln umgehen, ist dies eine Chance für mehr Lebensqualität, für weniger Schädigung der Umwelt und für eine Entschärfung des Welthungers.
Fast die Hälfte der Weltbevölkerung hat zu wenig Lebensmittel für eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Hunger ist die häufigste Todesursache auf der Erde. Gleichzeitig wird weltweit etwa ein Drittel der verfügbaren Lebensmittel verschwendet. Alleine die Lebensmittel, welche in Europa und den USA weggeworfen werden, würden ausreichen, um alle Hungernden der Welt drei bis sieben Mal zu sättigen. Wie kommt es dazu, dass Milliarden von Leuten sterben, weil ihnen etwas fehlt, wovon es mehr als genug hat? Lebensmittel sind ein Spezialfall Die Problematik des Welthungers ist komplex und kann nicht mit zwei Sätzen gelöst werden. Trotzdem gibt es entscheidende Mechanismen, bei denen auch wir eine Schlüsselrolle spielen. Wir sind uns aber kaum bewusst, wie viel wir mit unserem Verhalten bewirken. In der Regel haben wir in der industrialisierten Welt den Eindruck, dass wir absolut frei sind, mit unseren Einkäufen zu machen, was wir wollen, so lange wir anderen keinen Schaden zufügen. Wenn wir zum Beispiel keine Sorge zu unserem Fotoapparat tragen, ihn auf den Boden fallen lassen oder in die pralle Sonne stellen, geht er schneller kaputt und wir müssen früher einen neuen kaufen. Da wir ihn selber bezahlen, tragen wir auch die Verantwortung. Wer auf der anderen Seite sein Fahrrad gut pflegt und nicht auf der versalzenen Strasse herumfährt, wird belohnt durch eine längere Lebensdauer des Fahrrads. Anders ist es bei den Lebensmitteln. Der Umgang mit ihnen ist keine Privatsache, sondern eine ethisch und ökologisch höchst verantwortungsvolle Aufgabe. Wieso? Was macht Lebensmittel so einzigartig? Erstens sind Lebensmittel ein lebensnotwendiges Gut, eine unersetzbare Lebensgrundlage. Zweitens sind Lebensmittel begrenzt verfügbar. Wir können zwar die Produktion auf neue Flächen ausdehnen oder auf bestehenden Flächen intensivieren oder ertragsreichere Produkte anbauen. Aber der Anbau ist immer auf die knappen Ressourcen Land, Wasser und Energie angewiesen und mit Umweltbelastungen verbunden. Mehr Produktion bedingt mehr Arbeit und erhöht das Risiko, Ressourcen zu übernutzen und die Umwelt zu belasten. Die Verfügbarkeit an Lebensmitteln ist also beschränkt. Drittens werden viele Lebensmittel auf internationalen Märkten gehandelt und ihr Preis massgeblich durch Angebot und Nachfrage sowie Subventionierungen und Zollbestimmungen beeinflusst. Claudio Beretta schloss seinen Master in Umweltnaturwissenschaften ab. /
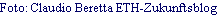 Was bedeutet das für uns? Wir kaufen den Armen das Brot weg Wenn ich im Laden drei Kilo Brot kaufe und nur zwei davon esse, so erhöhe ich «künstlich» die Nachfrage nach Brot. Die Schweiz importiert fast die Hälfte aller Lebensmittel aus dem Ausland. Je mehr wir verschwenden, desto mehr müssen wir importieren und desto mehr treiben wir die Lebensmittelpreise in die Höhe - für viele Leute an der Armutsgrenze genau über die Schwelle, bei der sie sich nicht mehr genug Lebensmittel leisten können. Wir können zwar die zwölf Kilo Brot, welche jeder Schweizer im Mittel pro Jahr wegwirft, nicht nach Afrika schicken - aber wir können das entsprechende Brot erst gar nicht kaufen. Auf diese Weise entlasten wir den begrenzten Weltmarkt und leisten so einen Beitrag gegen den Welthunger. Die Chance zu mehr Lebensqualität Damit wir weniger Lebensmittel verschwenden, müssen wir bewusster mit ihnen umgehen. Wir müssen den Einkauf besser planen, Frischprodukte öfter und dafür in kleineren Mengen kaufen, beim Zubereiten die Portionen abschätzen und nicht zu viel kochen und schliesslich etwas kreativer sein beim Resteverwerten. All dies tönt auf den ersten Blick nach Anstrengung und womöglich sogar nach Verzicht. Doch Verzicht worauf? In dieser Frage steckt der Schlüssel zur Lösung des Problems. Wenn wir weniger konsumieren, so verzichten wir auf den Konsum gewisser Lebensmittel. Verzichten wir damit auch auf Lebensqualität? Dazu ein paar Überlegungen:
Wenn wir bewusster mit unseren Lebensmitteln umgehen, so bringen wir ihnen mehr Wertschätzung entgegen. Weniger Verschwendung heisst dann Gewinn an Lebensqualität. Zum Autor: Claudio Beretta schloss seinen Master in Umweltnaturwissenschaften ab mit Schwerpunkten in Wald- und Landschaftsmanagement, nachhaltigen Energiesystemen und Lebensmittelverschwendung. Er arbeitet am Institut für Umweltentscheidungen der ETH Zürich, wo er im Sommer seine Doktorarbeit beginnen wird.
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|