|
Freitag, 8. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Werden Klimamassnahmen unterschätzt, drohen FehlinvestitionenIn der Klimapolitik klaffen Ziele und Realität oft weit auseinander. Die Ambivalenz und Widersprüche im Umgang mit fossilen Energieträgern möchte ich anhand zweier Beispiele aus Luftfahrt und Aktienmärkten thematisieren.Gastautor Prof. Klaus Ragaller, SATW / Quelle: ETH-Zukunftsblog / Dienstag, 27. August 2013 / 11:45 h
«Das Luftverkehrssystem Schweiz am Limit» meldete die NZZ am 29.7.2013. Jährlich steigt die Zahl der Passagiere mit 4 Prozent an - ein Zuwachs, der 2030 zu 40 Millionen Fluggästen führen würde, fast doppelt so viele wie heute. Massive Investitionen in die Infrastruktur wären zur Bewältigung dieses zukünftigen Verkehrs nötig. Wie aber würde sich das mit den von der Schweiz eingegangenen Verpflichtungen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen vertragen?
Ambivalente Planungen Das Beispiel zeigt einen weitverbreiteten ambivalenten Umgang mit der Klimaproblematik. Einerseits hat sich die Schweiz gesetzlich zu einer Reduktion der Treibhausgasemissionen um 20 Prozent bis 2020 verpflichtet. Das den Bund beratende Organ für Fragen der Klimaänderung (OcCC) empfiehlt darüber hinaus, bis zum Jahr 2050 eine Reduktion von 80 bis 95 Prozent. Die Stimmbürger haben diese Ziele wiederholt unterstützt: Zürich und weitere Gemeinden haben für die 2000-Watt-Gesellschaft gestimmt, was rund einer Tonne CO₂-Ausstoss pro Kopf und Jahr entspricht. Andererseits werden in der Schweiz im Schnitt jährlich pro Person 5000 Kilometer geflogen - mit steigender Tendenz. Bei angenommenen fünf Economy-Flügen führt das zu CO₂-Emissionen von etwa 1.4 Tonnen pro Kopf. Gastautor Prof. Klaus Ragaller. /
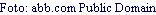 Das ist um Faktoren höher als der Anteil, der fürs Fliegen in einem persönlichen Gesamtbudget von einer Tonne zur Verfügung steht, selbst wenn die von der EU angepeilten 40 Prozent Bioflugtreibstoff bis 2050 erreicht werden sollten. Derartige Widersprüche ziehen sich durch sehr viele Bereiche fossiler Energie-Nutzung und -Produktion. Kommt die «Kohlenstoff-Blase»? Carbon Tracker - eine Initiative mit dem Ziel, das Handelsvolumen von Kohlenstoff an den Aktienmärkten zu erfassen - hat zusammen mit der London School of Economics den Bericht «Unburnable Carbon» verfasst («unburnable carbon» bedeutet Kohlenstoff, der nicht verbrannt werden darf, wenn das 2-Grad-Ziel noch erreicht werden soll: siehe Link). Darin werden die enormen Risiken untersucht, die bei einer weiteren Unterschätzung der Klimamassnahmen drohen. Die fossile Industrie investiert 647 Milliarden Dollar jährlich in die Erschliessung neuer Vorkommen, obwohl die gesicherten und potentiellen Reserven bereits dreimal grösser sind als die Menge, die zur Einhaltung des Zwei-Grad-Ziels noch verbrannt werden darf. Falls diese Investitionen mit derselben Intensität fortgesetzt werden, würde sich innerhalb von zehn Jahren eine «Blase» von 6 Billionen (Tausend Milliarden) Dollar bilden. Daran könnte auch eine noch so optimistische Einschätzung der CCS-Technik (Carbon Capture and Storage; CO₂-Abscheidung und -Speicherung) grundsätzlich nichts ändern. Der Grund für dieses «mispricing» sei einerseits die Trägheit des Systems: Bisherige Normen und Traditionen, die sich an den fossilen Reserven orientieren, bestimmen weiterhin den Wert der involvierten Firmen. Andererseits könnten auch Unklarheiten über die Durchsetzungsfähigkeit von griffigen Massnahmen eine Rolle spielen. Zum Vergleich: das Investitionsvolumen in Erneuerbare Energien betrug 2012 laut dem Netzwerk für erneuerbare Energien des 21. Jahrhunderts «REN21» weltweit 244 Milliarden Dollar, also nur etwa 38 Prozent der genannten fossilen Investitionen. Trotzdem bedrängen die Erneuerbaren (zusammen mit Gas und besserer Energieeffizienz) bereits die bisherige Spitzenposition der Kohle - dies zumindest besagt eine Analyse von Goldman Sachs mit dem Titel «The window for thermal coal investment is closing». Zum Autor: Gastautor Prof. Klaus Ragaller war bis zu seiner Pensionierung Direktor bei ABB. Seither setzt er sich im Rahmen der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften SATW für den Wissenstransfer ein.
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|