Dies lenkt von den wirklichen Herausforderungen der Klimaänderung ab, birgt aber eine entscheidende Frage: wie soll und kann die Wissenschaft ihre Resultate in den Dialog mit der Gesellschaft, Wirtschaft und Politik einbringen?
140 Zeichen für ein Gezwitscher auf Twitter: Kurznachrichten sind «in» - und für mich eine Tortur, wenn sogar Wissenschaft in diese Kurzform kondensiert werden soll. Dies zudem bitte immer objektiv, wertfrei, und sofort nutzbar, damit etwa die Politik faktenbasiert entscheiden kann. Da bleibt wenig Platz für differenziertes Denken oder gar für die Erläuterung von Unsicherheiten.
Nur Fakten liefern oder Einfluss nehmen?
Aber wehe dem Wissenschaftler, der eine klare Aussage macht und die Konsequenzen seiner Resultate darlegt. Vor einigen Wochen zeigten die Berner Klimaforscher Folgendes: wenn zusätzlich zum Zwei-Grad-Temperaturziel der Meeresspiegelanstieg oder die Versauerung der Ozeane beschränkt werden soll, müssten die CO₂-Emissionen noch stärker reduziert werden. Prompt wurden diese neuen Klimaziele von der NZZ am Sonntag als «inflationär» bezeichnet. Dabei hatten die Forscher nur die Konsequenzen verschiedener Beschränkungen aufgezeigt, ohne zu urteilen, ob diese Ziele erreichbar sind.
Einige Wissenschaftler versuchten zu stark, die Politik zu bestimmen, argumentieren Hans von Storch und Werner Krauss in ihrem Buch «Die Klimafalle». Damit haben sie wohl Recht. Aber daraus zu schliessen, dass wir deswegen bei den internationalen Klimaverhandlungen nicht weiter sind, greift zu kurz. Dass die internationale Klimapolitik stagniert, ist nur am Rande ein wissenschaftliches oder kommunikatives Problem. Verantwortlich sind andere Gründe: Erstens ist Klimapolitik primär Interessens- und Wirtschaftspolitik, besonders in China und den USA, den beiden weltgrössten CO₂-Emittenten. Zweitens ist der Klimawandel kaum greifbar, denn weder CO₂-Emissionen noch die Veränderung der globalen Mitteltemperatur sind direkt sicht- oder spürbar. Und drittens stellt uns der Klimawandel vor ein ethisches Problem: wir denken kurzfristig und lokal - trotz globaler Dimension - und hinterlassen unseren Kindern unbequeme Altlasten.



Reto Knutti ist Professor für Klimaphysik an der ETH Zürich. /




Die Unterscheidung von Fakten, Werten und Meinungen ist oft ungenügend und führt zu Missverständnissen. /
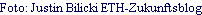

Dies erinnert an das ungelöste Problem der Endlagerung radioaktiver Abfälle.
Interpretation tut Not
Die Wissenschaft produziert Zahlen und Fakten, die objektiv und wertfrei sein sollen. Zahlen und Fakten allein sind aber nicht viel wert. Die Interpretation durch Experten ist entsprechend wichtig. Und wir brauchen ein gemeinsames Werte-Verständnis, nach dem wir diese Fakten einordnen. Denn obwohl der Klimawandel ein Fakt ist, bedeutet das noch lange nicht, dass wir etwas dagegen tun wollen. Die letzten zwanzig Jahre zeigen, dass die Bereitschaft dazu weitgehend fehlt, weil wir andere Interessen höher gewichten. Die Unterscheidung von Fakten, Werten und Meinungen ist oft ungenügend und führt zu Missverständnissen.
Echter Dialog als Herausforderung
Wissenschaftliche Information ist nie perfekt. Die Wissenschaft muss versuchen, ihre Unsicherheiten klar aufzuzeigen. Im Gegenzug müssen Medien und Politik aber auch bereit sein, differenzierte Aussagen zu akzeptieren. Die Unsicherheiten dürfen nicht als Argument missbraucht werden, um nichts zu tun. Schliesslich sind wir uns gewohnt, im täglichen Leben mit Unsicherheiten umzugehen.
Der Glaube, dass wir uns jetzt alle auf eine Strategie einigen und diese hundert Jahre stur verfolgen werden, ist unsinnig. Wir werden unsere Entscheide laufend überdenken müssen. Konstanter Dialog und Auseinandersetzung sind dafür zwingend. Der ehrliche und zielführende Dialog zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Medien und Gesellschaft ist wahrscheinlich die grössere Herausforderung als die Entwicklung des nächsten Klimamodells - eine Herausforderung, der die Hochschulen zu wenig Aufmerksamkeit schenken.