|
Sonntag, 10. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Auch Irrsinn macht GewinnDer riesige Wirbel um Obamacare brachte auch in Europa einige Kommentatoren auf den Plan, die staatliche Eingriffe in das Gesundheitswesen hinterfragten und behaupteten, dass es vermutlich allen besser gehen würde, wenn Medizin nicht von schwerfälligen staatlich regulierten Organisationen, sondern von agilen Playern aus der Wirtschaft organisiert würde.Patrik Etschmayer / Quelle: news.ch / Mittwoch, 23. Oktober 2013 / 14:30 h
Die Idee dahinter ist, dass der Markt am besten wisse, was der Mensch will. Doch in diese Logik sind einige Missverständnisse integriert. Wer die Behandlung eines Patienten mit Krebstumor mit einem Handy, die Heilung eines Kindes mit Lungenentzündung mit einem Fernseher und die Betreuung eines an Parkinson Leidenden mit einer Polstergruppe gleichsetzt, hat irgendwann ein grosses Stück seiner Menschlichkeit liegen gelassen.
Existentielle Bedürfnisse haben - aus der rein kapitalistischen Sicht - den enormen Vorteil, dass der Kunde praktisch nicht wählen kann, ob er oder sie auch Kunde sein will. Dazu muss man nicht einmal bis in die Medizin gehen. Nehmen wir nur mal Trinkwasser.
Sauberes, keimfreies Wasser ist ein Gut, dass vermutlich genau so viel zum Wohlbefinden und zur Gesundheit von Millionen beigetragen hat, wie jede medizinische Entdeckung. Eine privatisierte Wasserversorgung ohne strikte unabhängige Kontrolle böte unzählige Möglichkeiten, obszöne Gewinne zu machen. Der Kunde hätte dabei kaum Möglichkeiten, sich zu wehren und müsste wohl oder übel bezahlen, wenn er nicht mit Kübeln an den nächsten öffentlichen Brunnen gehen will... solange es diese noch gibt.
Bei der Gesundheit ist alles noch viel extremer. Wer ernsthaft krank ist und nicht sterben will, ist auf medizinische Betreuung angewiesen. Und selbst im hiesigen, angeblich egalitären Gesundheitswesen ist bereits jetzt so Manches im Argen, denn der Markt bestimmt schon jetzt vielfach, wer lebt oder wer stirbt.
Der beste Ratschlag ist wohl dieser: Bekommen sie eine häufige Krankheit, und zwar eine, für die man viele teure Medikament über längere Zeit einnehmen muss. Denn seien wir realistisch: Eine solche Krankheit ist bei Pharmafirmen äusserst beliebt.
MRI-Tomograph: Die gleichen Multis sorgen für Krankheit, Diagnose und Heilung. /
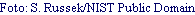 Mit einem solchen Leiden sind Sie ein Kunde, wie man ihn sich nur wünschen kann: zuverlässig, treu, gewinnbringend. Für solche Leiden werden auch immer wieder neue Wirkstoffe gesucht oder die alten leicht abgeändert, so dass der Patentschutz weiter besteht, der Goldesel weiterhin Gewinne scheisst. Sollten hingegen das Patent für Ihr Medikament endgültig abgelaufen sein, der Markt aber recht klein und die Herstellung schwierig, dann haben Sie Pech gehabt - die Gewinnmarge wäre einfach zu tief, da ab einem gewissen Preis die Konkurrenz mit einsteigen würde, ein Nullsummenspiel, bei dem keine wirtschaftlich ernsthaft geführte Pharmafirma einsteigt. Sterben sie lieber in Frieden. Und wenn Sie eine ziemlich seltene Krankheit haben, die spezielle Medikamente und Wirkstoffe erfordert? Pech gehabt. Wenn es keinen Markt dafür gibt, der die Aktienkurse beflügeln könnte, wird auch nichts hergestellt. Doch ein Pharma-, Chemie- oder Industrie-Gigant (vergessen wir nicht die Diagnostik-Maschinen vom Magnetresnonanz-Tomograph bis zum 3D-Ultraschallgerät) hat noch weitere Möglichkeiten. In den USA zum Beispiel gehören nicht wenige der grössten Pharma- und Diagnostik-Geräte-Hersteller auch zu jenen, die durch die verantwortungslose Verschmutzung von Gewässern und Böden mit dafür sorgen, dass ihr Kundenstamm garantiert nicht kleiner wird. Denn zu einem guten Unternehmen gehört nicht nur die Erschaffung eines Produktes sondern auch die Sicherstellung des Kundenbedürfnisses nach diesem: Mehr Kranke brauchen mehr Medikamente und Diagnose. Sie glauben, das sei zynisch? Der Kampf der Industrie-Lobbys gegen jede Verschärfung von Umwelt-Standards hat einerseits sicher mit Angst vor zusätzlichen Kosten zu tun, doch viele der grossen Multis profitieren dereinst von den Kollateralschäden, die sie bis zu strengeren Gesetzen völlig legal verursachen dürfen. Die Chancen sind für einen Multi gut, erst den Schaden anzurichten und dann auf mehrfache Weise an so einem zu verdienen: Sei es an der Behandlung durch Umweltgifte erkrankter Menschen oder an den Sanierungsarbeiten an verseuchten Böden. So etwas nennt man eine ganzheitliche Geschäftsstrategie. Oder pervers. Je nach Standpunkt. Faktum ist, dass - rein ökonomisch gesehen - ein geheilter Patient ein schlechter Patient ist. Rein ökonomisch ist es auch egal, ob sich ein Mensch einbildet, krank zu sein, oder wirklich erkrankt ist, solange er nur nach Medikamenten (oder so genannten «alternativen Heilmitteln») greift und für diese zahlt oder von der Versicherung zahlen lässt. Die Angst vor der Krankheit kann daher wirtschaftlich gesehen fast gleichviel wert sein, wie die Krankheit selbst. Ein Gesundheitswesen, das sämtliche ethischen, moralischen und menschlichen Regungen einer merkantilistischen Sichtweise unterordnen würde (und scheinbar ist dies ein Wunschtraum mancher radikal-Markt-Fans), wäre ein Gesundheitssystem, das Krankheiten fördert, das endlose Behandlung der Heilung vorzieht, das jene, die an seltenen Krankheiten leiden, unbehandelt sterben lässt und das die Behandlungsqualität im Sinne der Bruttomarge einer Krankheit bewertet. Wir sind bereits auf dem Weg zu einem solchen System, in dem das Leben eines Menschen als potentieller Kurs-Booster für Pharmaaktien betrachtet wird. Der Glaube, dass es besser ist, ein solches System zu fördern, statt zu bremsen oder zu verhindern, grenzt an Irrsinn. Doch das ist ja auch nicht schlecht: Auch Psychopharmaka bringen jede Menge Gewinn. Nicht wahr?
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|