Betroffen sind etwa die Energieversorgung, die Landwirtschaft, die Siedlungswasserwirtschaft oder der Verkehrssektor. Bei solchen Transitionen oder Übergängen geht es um tiefgreifende Veränderungen von Wirtschaft und Gesellschaft. Sie bringen nicht nur neue Technologien mit sich, sondern auch neue Geschäftsmodelle, veränderte institutionelle Strukturen, andere Nutzungspraktiken und Lebensstile. Transitionen sind Veränderungsprozesse über lange Zeiträume - sie können 50 Jahre und länger dauern. Ein Beispiel ist die angestrebte Energiewende. Der Energiesektor hat bereits in der Vergangenheit mehrere Transitionen durchlaufen. Im Heizungsbereich zählen dazu der Übergang von Holz zu Kohle und später jener von Kohle zu Erdöl und Erdgas. Falls in Zukunft ein grosser Teil unserer Energieversorgung auf erneuerbaren Energien basieren würde, wäre dies die Folge einer erneuten Transition, die in Bezug auf Nachhaltigkeit vermutlich echte Fortschritte brächte.
Gesellschaftlicher Umbruch
«Sustainability Transitions» müssen hohe Hürden nehmen. Diese sind in erster Linie gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Natur: Konsumenten sind mitunter nicht bereit, höhere Strompreise zu bezahlen oder auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen. Elektrizitätswerke (und ihre Eigentümer) haben ein Interesse, bestehende Kraftwerke so lange wie möglich zu nutzen. Und Automobilhersteller wollen strengere Abgasvorschriften verhindern.



Jochen Markard ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent an der Professur für Nachhaltigkeit und Technologie an der ETH Zürich. /
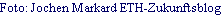



Sustainability Transition: Offshore Windfarm. /




Illustration: historische Transition im Transportsektor. /


Im Zuge von Transitionen gibt es Gewinner, aber auch Verlierer - und dementsprechend Widerstände. Daher werden grundlegende Veränderungen meist erst möglich, wenn die bestehenden Strukturen in einer tiefen Krise sind oder durch besondere Ereignisse destabilisiert werden, wie zum Beispiel durch Fukushima oder steigende Ölpreise.
Der grundlegende Wandel von Wirtschaftssektoren (im Fachjargon spricht man von sozio-technischen Systemen) ist eines der komplexesten Phänomene in den Sozialwissenschaften. Es geht nicht allein um die Dynamik von einzelnen Technologien wie etwa der Photovoltaik, sondern um das Zusammenspiel zahlreicher komplementärer Technologien, darunter Windkraft, Biogas, Wärmepumpen, Stromspeicher oder intelligente Stromnetze (Smart Grids). Es geht nicht allein um die Technik, sondern insbesondere auch um die Wirtschaft: etablierte Wertschöpfungsnetzwerke verändern sich, neue Firmen und Geschäftsmodelle entstehen und letztlich auch neue Berufe und Studiengänge. Auf Konsumentenseite wiederum geht es nicht nur um Information und Aufklärung, sondern um die Veränderung von Gewohnheiten, Werten, Praktiken und Routinen.
Herausforderungen für die Forschung
Es bedarf daher Beiträge und Fachkenntnisse aus einer Vielzahl von Disziplinen, von den Ingenieur- und Naturwissenschaften über die Wirtschaftswissenschaften bis hin zu Soziologie und Politikwissenschaft. Dieser interdisziplinäre Mix stellt gleichermassen eine Bereicherung und Herausforderung dar. Es gilt, Konzepte und Modelle zu entwickeln, die Erkenntnisse aus verschiedenen Fachgebieten vereinen - oder aber parallel mit verschiedenen Ansätzen zu arbeiten und damit unterschiedliche Sichtweisen auf das gleiche Phänomen zu ermöglichen. Ähnliches gilt für die Methodenvielfalt.
Eine weitere Herausforderung für die Forschung ist es, die Grenzen des Vorhersagbaren und Beeinflussbaren anzuerkennen. Aufgrund der Komplexität von «Sustainability Transitions» wird es letztlich nur bedingt möglich sein, klassische Gestaltungsvorschläge zu machen oder Politik- und Strategieempfehlungen zu geben. Umso wichtiger wird es sein, sowohl künftige Infrastrukturen als auch organisatorische und institutionelle Strukturen (einschliesslich politischer Instrumente) flexibel zu gestalten, damit sie besser in der Lage sind, sich an zukünftige Veränderungen anzupassen.
Unlängst fand an der ETH Zürich eine internationale Konferenz zu «Sustainability Transitions» statt. Rund 200 Forschende aus der ganzen Welt trafen sich während drei Tagen, um Forschungsergebnisse auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Die Konferenz hat gezeigt, dass es mittlerweile ein stabiles Netzwerk von Forschenden gibt, die sich diesem komplexen Thema verschrieben haben. Das neue Forschungsfeld wird auch in den folgenden Jahren weiter wachsen - nicht zuletzt getrieben durch die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen, die uns bevorstehen.