|
Freitag, 15. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Der Hund im RechtKeine andere Tierart wird vom Tierschutzrecht so umfangreich erfasst wie der Hund. Neben dem Tierschutzgesetz und der dazugehörigen Tierschutzverordnung müssen Hundehaltende zahlreiche weitere Bestimmungen beachten, etwa solche des Tierseuchen-, Jagd- oder Zivilrechts.li / Quelle: Tier im Recht / Dienstag, 16. September 2014 / 15:57 h
Von zentraler Bedeutung für den Umgang mit Hunden ist aber die Tierschutzgesetzgebung. Diese enthält einerseits grundsätzliche Normen für alle Tierarten aber auch eine Vielzahl von Regelungen, die sich speziell der Haltung von Hunden widmen.
Zahlreiche Detailbestimmungen in der Tierschutzgesetzgebung Generell gilt, dass ein Hund so aufgezogen, gehalten und ausgebildet werden muss, dass er einen ausgeglichenen Charakter hat, gut sozialisiert ist, sich gegenüber Menschen und anderen Tieren nicht aggressiv zeigt und weder Menschen noch andere Tiere gefährdet. Gesetzliche Mindestvorschriften bestehen ferner bezüglich der wichtigen Bereiche Sozialkontakte und Bewegung. Hunde sind jeden Tag im Freien auszuführen. Können den Tieren keine ausgiebigen Spaziergänge geboten werden, muss ihnen zumindest täglicher Auslauf gewährt werden, wobei der Aufenthalt im Zwinger oder an einer Laufkette nicht als Auslauf gilt. Die Haltung von Hunden an der Laufkette ist allerdings nicht vollständig verboten, sofern den Tieren eine Fläche von mindestens 20 Quadratmetern zur Verfügung steht und sie sich mindestens fünf Stunden täglich frei bewegen können. Zusätzlich zu den gesamtschweizerischen Vorschriften müssen auch die verschiedenen kantonalen und kommunalen Hundegesetze und -verordnungen befolgt werden.Verbotene Handlungen und Ausbildungspflicht Auch der Einsatz von Hilfsmitteln zur Hundeerziehung wird in der Tierschutzverordnung geregelt. Dabei gilt der Grundsatz, dass diese nicht so verwendet werden dürfen, dass der Hund Verletzungen oder erhebliche Schmerzen erleidet oder dass er stark gereizt oder in Angst versetzt wird. Um gewisse Grundkenntnisse sicherzustellen, ist jedermann, der einen Hund erwerben möchte, zur Erbringung eines sogenannten Sachkundenachweises verpflichtet.Chip- und Steuerpflicht Seit 2007 müssen Hunde in der Schweiz gemäss Tierseuchengesetzgebung durch einen Mikrochip gekennzeichnet sein. Die Verantwortung dafür, dass ein Hund spätestens drei Monate nach der Geburt - in jedem Fall aber vor der Weitergabe an einen neuen Besitzer - gechippt wird, liegt beim Tierhalter. Darüber hinaus sind sämtliche Hunde beim Animal Identity Service (ANIS) zu registrieren. Es müssen auch die verschiedenen kantonalen und kommunalen Hundegesetze und -verordnungen befolgt werden. /
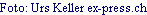 Kommt der Halter dieser Pflicht nicht nach, riskiert er eine Busse. Ausserdem sehen sämtliche Kantone vor, dass für die Haltung von Hunden eine Steuer zu entrichten ist beziehungsweise dass ihre Gemeinden eine solche Steuer erheben können. Nachbarschaftsstreitigkeiten und Haftungsfragen Hundehaltende sind nicht selten auch mit zivilrechtlichen Fragen konfrontiert. Einen klassischen Streitpunkt stellt etwa die Frage dar, wie viel Hundegebell von den Nachbarn zu tolerieren ist. Eine eindeutige Antwort hierauf gibt es nicht. Gemäss Zivilgesetzbuch (ZGB) darf die Lärmbelästigung nicht übermässig sein. Zivilrechtliche Auseinandersetzungen können sich auch ergeben, wenn ein Hund einen Menschen oder ein anderes Tier beisst und sich die Frage stellt, wer für den Schaden aufzukommen hat. Im Normalfall haftet der Halter des Hundes. Er kann sich jedoch von der Haftung befreien, wenn er nachweisen kann, dass der Schaden eingetreten ist, obwohl er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt bei der Beaufsichtigung seines Hundes aufgebracht hat. Dies gelingt allerdings sehr selten, da die Anforderungen an diesen sogenannten Sorgfaltsbeweis in der Praxis enorm streng sind.Hunde sind am häufigsten Opfer von Tierschutzverstössen Die jährlichen Analysen der Schweizer Tierschutzstrafpraxis durch die TIR (einsehbar unter www.tierimrecht.org; Banner «Tierschutzstraffälle») zeigen, dass Hunde die mit Abstand am häufigsten von Tierschutzdelikten betroffenen Tiere sind. Über die Gründe hierfür kann nur spekuliert werden. Möglicherweise birgt die besonders enge Bindung des Hundes zum Menschen ein erhöhtes Konfliktpotenzial. Denkbar ist auch, dass die seit einigen Jahren sehr emotional geführte öffentliche Debatte über «Kampfhunde» ebenso zu einer Steigerung der Gewaltbereitschaft gegenüber Hunden wie zu einer höheren Sensibilität der Gesellschaft und der Behörden für Straftaten an Hunden geführt hat. Entscheidend ist jedenfalls, dass die rechtsanwendenden Instanzen hundefeindliche Tendenzen nicht tolerieren und entsprechende Delikte konsequent bestrafen, um potenzielle Täter von Tierquälereien abzuhalten.
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|