Reta Caspar / Quelle: news.ch / Donnerstag, 29. Oktober 2015 / 09:17 h
Europaweit werden derzeit Kirchen umgenutzt. Unproblematisch sind Nutzungen als Grabstätten (sic!) (z. B. Grabeskirche St. Josef in Aachen) oder private Nutzungen als Wohn- oder Büroräume. Ebenfalls unproblematisch sind öffentliche Nutzungen wie Konzerträume, Bibliotheken oder Galerien, oder kommerzielle Nutzungen wie z.B. eine Bierbrauerei samt Bar (z. B. die Jopenkerk in Haarlem, NL).
Anders sieht es aus, wenn der Staat selbst die Räume nutzt, oder sie für staatlich beaufsichtigte Aufgaben bereitgestellt werden. Da kann unter anderem ein klares Zeichen - architektonisch oder mittels einer Inschrift - nötig sein, damit die religiöse Sprache der Architektur nicht mit der aktuellen Nutzung in Verbindung gebracht wird.
Besonders schwierig wird es, wenn in solchen - längst nicht mehr religiös genutzten - Räumen gesellschaftspolitische bedeutende Anlässe durchgeführt werden. Wenn dann noch Akteure beteiligt sind, die mit der europäische Säkularisierung wenig vertraut sind, kann die religiöse Sprache der Architektur sie dazu verleiten, den Anlass und das Publikum als religiös konnotiert zu verstehen.
Das ist wohl in der Frankfurter Paulskirche geschehen.
Als grösster und modernster Saal Frankfurts bot sie sich 1848 «als Sitz für das erste gesamtdeutsche Parlament an. Hier schuf die Nationalversammlung die erste demokratische Verfassung für Deutschland.



Auch wenn's nicht so aussieht: Die Paulskirche ist keine Kirche mehr. /
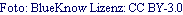

Auch nach Auflösung des Parlaments fanden in der Paulskirche nationale Gedächtnisfeiern statt. Zur Gedenkstätte wurde die Paulskirche 1913 während der Jahrhundertfeier zum Gedenken an die Freiheitskriege. 1944 wurde die Paulskirche komplett zerstört. Ihr Neuaufbau begann kurz nach Kriegsende. Eingeweiht wurde sie am 18. Mai 1948 anlässlich der Hundertjahrfeier der Deutschen Nationalversammlung. Seitdem dient sie ausschliesslich als Ort der Erinnerung an den Beginn der deutschen Demokratie.»
Diese Kirche wurde also zum Ort konfessionsloser, zivilreligiöser Feierstunden der Bundesrepublik u. a. für den seit 1950 vergebenen Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.
Wenn nun ein Preisträger - iranischer Abstammung, aber in Deutschland geboren und aufgewachsen und mit der deutschen Realität sogar bestens vertraut - wenn also ein bestens integrierter Vorzeigemuslim an einem Anlass in der Paulskirche zum Gebet auffordert, dann dürfte ihn möglicherweise die religiöse Sprache deren Architektur dazu verleitet haben. Ein Jahr zuvor, bei seiner Rede zu «65 Jahre Grundgesetz» vor dem deutschen Parlament hat er es jedenfalls nicht getan.
Die Macht der Optik darf nicht unterschätzt werden. Christliche Symbole dominieren den öffentlichen Raum unserer religiös distanzierten Gesellschaft im Übermass. Dasselbe gilt für das Fernsehen, wo oftmals Kirchen oder religiöse Symbole ins Bild rücken, obwohl sie mit dem Inhalt der Meldung gar nichts zu tun haben.
2010 hat im Rahmen des NFP 58 eine Studie an der Uni Fribourg ergeben: «Religionen sind, wenn auch nicht immer explizit, im Fernsehalltag der Schweiz allgegenwärtig. In einer ersten flächendeckenden Analyse wurden alle Sendungen und Beiträge markiert, in denen mindestens ein - auf welche Religion auch immer bezogenes - religiöses Symbol identifizierbar war (ˏTagging´), vom Kreuz um den Hals des Sportlers bis zur Kirche als architektonischem Artefakt. Im Durchschnitt aller Programmsparten ist in Folge der sehr offenen Codierung in fast der Hälfte aller Untersuchungseinheiten ein Religionsbezug feststellbar (48 Prozent).»
Die AutorInnen wiesen klar darauf hin, dass diese Omnipräsenz religiöser Symbole von den Einheimischen infolge optischer Gewöhnung kaum mehr als solche wahrgenommen, von Zugewanderten aus anderen Kulturkreisen aber ganz anders verstanden wird.
Mit dem heute noch verbreitetem Hang des Denkmalschutzes zur Erhaltung aller sakralen Gebäude handeln wir uns also das Problem ein, dass unsere Umgebung strotzt von religiösen Symbolen und den Anschein erweckt, dass hier allenthalben religiös gelebt wird.
Hüten wir uns deshalb von einem Übermass an falschen Signalen.