Mattea Meyer / Quelle: news.ch / Freitag, 5. November 2010 / 19:47 h
Die Schweiz – ein Land des Föderalismus. Es gibt z.B. nicht ein Volksschulgesetz, es gibt deren 26. Der Föderalismus ist eine Folge des Sonderbundkrieges und der Gründung des Bundesstaates 1848. Die besiegten Katholisch-Konservativen standen den protestantisch-fortschrittlichen Siegerkräften gegenüber. Als Kompromiss wurde ein föderalistisches System mit geringer Zentralgewalt geschaffen, das bis heute Bestand hat.
Die Schweiz beschützt den Föderalismus – also das Selbstbestimmungsrecht der Kantone – wie ein kleines Pflänzchen. Sicherlich bringt er viele Vorteile mit sich: es können konkrete Lösungen für spezifische kantonale Probleme gefunden werden, ohne dass die Lösung allen Kantonen aufgezwungen wird. Schliesslich steht der Berg- und Tourismuskanton Graubünden vor anderen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen als der urbane Kanton Zürich. So kommt es denn auch, dass im Kanton Zürich andere Gesetze und Massnahmen ergriffen werden als im Kanton Graubünden.
Dieses Föderalismus-Pflänzchen ist in gewissen Bereichen aber nicht so harmlos, wie es scheint. Es schlägt Wurzeln, wuchert wild und kann den Boden vergiften. Dann nämlich, wenn es den Kantonen nur noch darum geht, der beste zu sein, koste es, was es wolle.



Manche Kantone können den Reichen Steuerhäppchen servieren. /
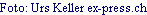

Das beste Beispiel ist der Steuerwettbewerb, der seit Jahren wütet und immer absurdere Formen annimmt.
Die Kantone jagen sich mit Steuergeschenken gegenseitig die Millionäre ab. Der Kanton Obwalden versuchte sogar, mit degressiven Steuertarifen Superreiche anzulocken. Er kam zum Glück nicht weit, wurde er doch vom Bundesgericht zurückgepfiffen und muss auf degressive Steuersätze verzichten, da sie verfassungswidrig sind.
Der Steuerwettbewerb ist ein Kampf mit ungleich langen Spiessen. Kleine Kantone, die keine Zentrumslasten zu tragen haben, können grosszügig Steuergeschenke an Unternehmen, Millionäre und reiche AusländerInnen verteilen. Um nicht leer auszugehen, ziehen alle anderen Kantone mit, senken ihre Steuern für Reiche, verzichten auf Erbschaftssteuern und besteuern AusländerInnen nur pauschal. Dass dieses Steuerdumping nicht ohne Folgen bleibt, ist klar: wenn die Einnahmen fehlen, muss bei den Ausgaben, d.h. bei der Bildung, im Sozial- und Gesundheitswesen oder im Verkehr gespart werden.
Oder aber die Mindereinnahmen werden von den NormalverdienerInnen durch höhere Steuertarife bezahlt. Was wiederum zur Folge hat, dass ihnen weniger zum Leben bleibt. Die Schere zwischen arm und reich öffnet und öffnet sich.
Der ruinöse Wettbewerb, der nur den Reichsten nützt, gefährdet den nationalen Zusammenhalt. Eine Harmonisierung ist hier dringend angesagt – Föderalismus hin oder her.