|
Dienstag, 26. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
GaokaoDer Konfuzius-Tempel in Peking nahe der zweiten Ringstrasse war am Wochenende so gut besucht wie sonst nie im ganzen Jahr. Grosseltern, Eltern, Verwandte und Bekannte von Schülern und Schülerinnen bitten Konfuzius, den grossen Philosophen und mithin obersten Lehrer der chinesischen Zivilisation, um ein möglichst gutes Examen.Peter Achten / Quelle: news.ch / Dienstag, 7. Juni 2011 / 10:00 h
Es ist der «hohe Test» (Gaokao), jene Prüfung nach Abschluss der Mittelschule, welche den Eintritt in eine Hochschule erst ermöglicht. Gaokao hat eine lange Tradition und beruht auf der unter der Han-Dynastie (206 v.Chr. - 220 n.Chr) eingeführten System der Beamtenprüfung.
Während zu kaiserlichen Zeiten konfuzianische Klassiker auswendig gelernt worden sind, wird heute Schulwissen gepaukt und eingetrichtert. Auswendig lernen ist noch immer das A und O des chinesischen Schulsystems und des Erfolgs am Gaokao. Natürlich sind es heute nicht mehr die konfuzianischen Klassiker sondern landesweit die Grundfächer Chinesisch, Mathematik und eine Fremdsprache. Je nach späterem Studienwunsch kommen die naturwissenschaftlichen Fächer Physik, Chemie und Biologie, Geschichte und Geographie, Kunst, Musik, bildende Künste hinzu. Für alle obligatorisch ist nach wie vor politische Erziehung.
Von der Primar- bis zur Mittelschule pauken die chinesischen Kinder, sie sind oft übermüdet, finden kaum Zeit zum spielen. Die Eltern geben zudem viel Geld aus für Nachhilfestunden. Das alles, um die jährlichen Prüfungen möglichst glanzvoll zu bestehen. Die Krönung soll dann der «hohe Test» und der Universitätszugang sein.
Je nach Provinz sind die Gaokao-Examen leicht unterschiedlich gestaltet, der Leistungsnachweis allerdings ist vom Niveau her überall gleich hoch. Bei der Gründung des Volksrepublik 1949 wurde das Gaokao-System von der republikanischen Zeit übernommen. Als Staatengründer Mao Dsedong 1966 die «Grosse Proletarische Kulturrevolution» ausrief, wurden Prüfungen kurzerhand abgeschafft. Die intellektuelle Elite wurde aufs Land geschickt, um «bei den Bauern, den Massen zu lernen». Was fortan zählte, waren die Arbeiter, Bauern und Soldaten und eine «rote Gesinnung». China verlor so eine ganze Generation von Intellektuellen. Nach Maos Tod wurde Gaokao1977 vom grossen Reformer Deng Xiaoping wieder eingeführt. Die Konkurrenz war riesig. Jetzt zählte wieder Wissen und weniger nur die politische Gesinnung. Auf parteichchinesisch ausgedrückt: die Parole «rot statt Experte» gehörte der Vergangenheit an. In jenem Jahr stellten sich 5,7 Millionen Chinesinnen und Chinesen der Prüfung. Davon schafften gerade einmal fünf Prozent die Gaokao-Hürde, denn mangels Infrastruktur sowie vor allem Professoren und Lehrer standen damals nur 275'000 Studienplätze zur Verfügung.
In den letzten über drei Jahrzehnten hat sich wie in andern Bereichen der chinesischen Wirtschaft und Gesellschaft auch in der Erziehung vieles grundlegend verändert. Die Zentralregierung, Provinzen und Städte haben viel investiert, sowohl an Geld wie auch an Planung und Kreativität. Von der Grundschule bis zu den Hochschulen ist eine schon fast permanente Reform im Gang mit dem Ziel, internationales Niveau zu erreichen. Nach den Plänen der Zentralregierung sollen ähnlich wie im amerikanischen System rund hundert Elite-Universitäten entstehen auf dem Fundament von in Städten und Provinzen verbreiteten Lokal-Hochschulen. Unter anderem werden auch ausländische Experten und Professoren verpflichtet, um dieses Ziel zu erreichen.
Das chinesische System ist hoch kompetitiv geblieben. Von der Primar- bis zum Abschluss der oberen Mittelschule sind strenge Prüfungen die Norm. Der krönende Abschluss bildet Gaokao, das «hohe Examen», das über die Zukunft bestimmt. Heute - im Unterschied zur Wiederaufnahme der Prüfung 1977 - fallen anstatt 95 nur noch 31 Prozent (2010) der Prüflinge durch.
GaoKao Prüfungszimmer: Störsender und bewachter Toilettengang /
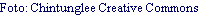 Vor fünf Jahren noch gab es nur Studienplätze für die Hälfte aller Bewerber; die Durchfallquote betrug also rund fünfzig Prozent. Die Zahlen zeigen, wie schnell die Reformen wirken. Wer versagt, kann es zwar ein Jahr später nochmals versuchen, doch für die Versager sieht, wie einst bei den Beamtenprüfungen im Kaiserreich, die Zukunft dunkel aus. Was den Druck erhöht ist auch die Tatsache, dass eine möglichst gute Note erreicht werden muss. Nur so nämlich ist es möglich, an einer der Top-Universitäten zu studieren, also beispielsweise an der Pekinger Beida oder an der Technischen Hochschule Tsinghua. Weil der Leistungsdruck und der Konkurrenzkampf so enorm sind, nimmt die ganze Nation während der drei Examenstage am Drama teil. Der Verkehr um die Prüfungsorte wird zum Teil umgeleitet und Arbeiten an lärmigen Grossbaustellen eingestellt, um eine möglichst ruhige Atmosphäre zu garantieren. Eltern geben viel Geld aus und buchen dem Sohn oder der Tochter ein Hotelzimmer in der Nähe, damit sie für die Prüfungstage möglichst ausgeruht sich der intellektuellen Herausforderung stellen können. Das Hotelzimmer ist selbstverständlich mit Klimaanlage gekühlt, denn anfangs Juni sind die Temperaturen in weiten Landesteilen - auch in Peking - weit über dreissig Grad. Damit Tochter Hua am Dienstag rechtzeitig beim Examen eintrifft, hat Vater Chen Lun extra eine Limousine mit Fahrer gebucht. «Vor der Prüfung möglichst keinerlei Stress, auch nicht auf dem Weg zum Gaokao im Verkehrsstau», sagt Chen. «Sie wird die Prüfung bestimmt schaffen», sind die Eltern Chen fest überzeugt; auch die beiden Grossväter und Grossmütter nicken bestimmt. Die Schulbehörden wachen ihrerseits, dass es, wenn immer möglich, zu keinen Unregelmässigkeiten kommt. Früher war mit Korruption, d.h. Geldgeschenken an der richtigen Stelle, oft im voraus an die Prüfungsfragen heranzukommen. Diese Zeiten sind praktisch vorbei, und falls es nachgewiesenermassen zu Unregelmässigkeiten kommt, wird streng durchgegriffen. Die neueste Herausforderung sind die digitalen Hilfsmittel. Dass deshalb mobile Telefone tabu sind, versteht sich von selbst. Sicherheitshalber wurden überall Störsender installiert. Toilettengang ist nur unter Bewachung möglich. Die Prüfungsfragen werden von der Volkspolizei in gesicherten Autos zu den Prüfungsorten gefahren. Das rigorose Prüfungsverfahren wird von Reformpädagogen mittlerweile hinterfragt. Die einseitige Gewichtung des Auswendiglernens von Schulstoff, so eines ihrer Argumente, fördere zu wenig die Kreativität und die heute so wichtige Innovationskraft. Zudem habe der Stress in der Mittelschule nachgewiesenermassen zu einer Häufung von Depressionen und Selbstmordversuchen geführt. Das Gaokao jedoch wird wohl nicht so schnell abgeschafft werden, ist es doch fester Bestandteil der chinesischen Kultur. Jene, die es sich leisten können, schicken unterdessen ihre Kinder zur Ausbildung ins Ausland und können sich deshalb das Gaokao ersparen. Das aber kostet Geld, sehr viel Geld. Ein Studienjahr in Australien, Amerika oder Europa ist unter umgerechnet rund 25'000 Franken pro Jahr nicht zu haben. Im akademischen Jahr 2009/10 studierten aber bereits 230'000 Chinesinnen und Chinesen im Ausland (u.a. auch in der Schweiz), und nach Schätzung von Experten werden es 2014 über eine halbe Million sein. In China jedenfalls werden ab Dienstag, dem 7. Juni bis am Donnerstag rund zehn Millionen Chinesinnen und Chinesen im ganzen Lande die Universitäts-Prüfung ablegen. Sieben Millionen werden bestehen. Sie werden aber in der «sozialistischen Marktwirtschaft chinesischer Prägung» - im Unterschied zu kaiserlichen Zeiten mit einem garantierten Beamtenstatus - nach dem Universitätsstudium nicht mit Sicherheit einen Arbeitsplatz finden. Nur drei von vier diplomierten Hochschülern nämlich findet nach Abschluss des Studiums auch einen Job.
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|