Regula Stämpfli / Quelle: news.ch / Mittwoch, 4. März 2015 / 10:06 h
Mit «Warum es die Welt nicht gibt» denkt Gabriel (hier ist der Name schon fast Programm...) alte Fragen auf erfrischende Art und Weise neu. «Sind wir nur eine Anhäufung von Elementarteilchen in einem riesigen Weltbehälter?» führt zur Antwort: «Ich kann in Aussicht stellen, dass ich behaupten werde, dass es alles gibt, bis auf eines: die Welt.» Kurz und gut: Es ist ein Philosophiebuch, das lustig, nachhaltig, streckenweise genial einmal mehr belegt, wie Denken Menschen zu den ungewöhnlichsten Zukünften führen könnte.
1755 verfasste ein preussischer Hauslehrer unter einem Pseudonym die kleine Schrift: «Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels.» Mit dieser erklärte der spätere Weltphilosoph Immanuel Kant die Grundlagen kosmologischer Wissenschaften, die 1922 durch Edwin Hubble bewiesen werden konnten. Kant tat dies ohne Messgeräte, sondern allein mit seinem Geist, womit sich Catos Weisheit, dass der Mensch nie tätiger sei als wenn er dem äusseren Anschein nach nichts tut, einmal mehr bewahrheitete.
Weshalb erzähle ich Ihnen dies alles? Weil Markus Gabriel seiner Empörung, dass ausgerechnet in Freiburg der Lehrstuhl von Husserl und Heidegger zugunsten eines formaltechnischen, analytischen Gebrabbels namens «Juniorprofessur für Logik und sprachanalytische Philosophie» abgeschafft werden sollte, viel zu wenig stark Ausdruck geben kann. Er sieht die Kontroverse in Freiburg im Lichte der Heidegger-Diskussionen betreffend dessen «Schwarze Hefte», verkennt aber, dass im Zuge der Bologna-Reform in Europa viel kritisches und nicht primär an Output orientiertes Denken aus den Universitäten verscherbelt werden soll. Freiburg nimmt die Heidegger-Kontroverse nur zum Anlass das zu tun, was die Universität Zürich im Fach Geschichte, schon längst und elegant gelöst hat, nämlich:
Ein Fach abzuschaffen, das keinen internationalen Mehrwert mehr bringt, obwohl es eigentliche Grundlage allen Verständnisses sein könnte.
Wer nach «Schweizergeschichte, Universität Zürich» googelt, kriegt folgenden Bescheid: «Dieses Studienprogramm ist auslaufend. Neueinschreibungen sind nicht möglich.» Der NZZ gibt Prof. Dr. Jakob Tanner anfang dieses Jahres Auskunft, weshalb Schweizergeschichte weder als Haupt- noch als Nebenfach an der Universität Zürich eine Berechtigung hat: «Seit der Streichung des Hauptfaches konnten wir beobachten, dass die Beschäftigung mit Themen zur Geschichte der Schweiz sowie ihrer Kantone und Regionen keineswegs gelitten hat, im Gegenteil. Wie intensiv wir uns mit der Schweiz auseinandersetzen, sehen Sie an Forschungsarbeiten aus dem letzten Semester: Da ging es um Schwarzarbeit, um die Werbeagentur Farner, um globale Aktivitäten des Roten Kreuzes oder um die
Aktion für Pflegekinder.»
Die Bologna-Reform, die 1999 in den Hinterzimmern von den europäischen und dem schweizerischen Bildungsminister als Geheimrevolution der letzten 200 Jahre konzipiert und mit entsprechender entpolitisierender, unkritischer auf Warenwissen ausgerichtete Bildung in ganz Europa durchgedrückt wird, zeigt also immer wieder politische Folgen, die aber als solche nie diskutiert werden. Was meine ich damit?
Universitäten sind nicht mehr dem Denken, sondern dem «Standortwettbewerb» (Zitat Tanner) verpflichtet. Universitäten führen zur Idiotie fachreduzierten Expertentums, das uns dann ausschliesslich technische Lösungen beschert statt demokratische und politische. Leihmutterschaft beispielsweise ist keine technische, sondern eine gesellschaftliche Frage, ebenso wie Alzheimer nicht einfach medizinisch, sondern gesamtgesellschaftlich «behandelt» werden muss. Doch nein: Man produziert an den philosophischen Fakultäten lieber Plastikfrauen mit technischem Sprachgefühl, die dann technischen «Fortschritte» wie Plastik-Verpackungen, Plastik-Kinder, Plastik-Politiken, Plastik-Medien an führender Stelle legitimieren können.



Zum Beispiel: Geschichtsereignis Schweizer Generalstreik: Bei uns nicht mehr Bildungsrelevant und am Auslaufen... /
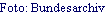

Dies ist in der Philosophie realtiv leicht zu entlarven wie es Markus Gabriel in seinem Artikel der Süddeutschen auch tut, doch im Fach Geschichte sind diese Zusammenhänge auf ersten Blick nicht so klar erkennbar.
Wer politische Geschichte, sei dies «Schweizergeschichte» oder «Verfassungsgeschichte» oder «Europäische Institutionengeschichte» in den historischen Fakultäten abschafft und - wenn überhaupt - in die juristischen oder warmwasserduschende Politologie abschiebt, verkennt, wie entscheidend das Studium klassischer Eckpfeiler von «Containerwissen» (Zitat Jakob Tanner) ist. Es gibt keine grossen Historiker und Historikerinnen, die keine Ahnung mehr haben von den entscheidenden Daten, Zusammenhängen, schweizerischer/europäischer Militärgeschichte und entscheidenden Räumen, die wann, wo, von wem zu welcher Herrschaft geführt haben. Wer beispielsweise alles über «Opfersoziologie», aber nichts mehr über die Organisation von Konzentrationslagern inklusive Jahresdaten, verfassungsrechtliche Daten, nationale Eckpunkte weiss, erzählt Auschwitz nicht nur völlig entpolitisiert, sondern individualisiert dermassen kriminell, dass keine mehr wissen soll, dass nicht einfach gute und böse Menschen, sondern klare Herrschaftsstrukturen, Literatur, Universitäten, spezifische Ereignisse, Jahre und Orte entscheidend waren.
Die von Jakob Tanner so gerühmte «Gebrauchsgeschichte» führt letztlich nur dazu,
unkritische Warenhistoriker heranzuziehen, die sich den ökonomischen und politischen Herrschern mit guter Kenntnis über Statistik
als Daten-Analysten anbieten können. Völlig absurd ist es daher, dass sogenannt «linke» Kräfte in der Schweiz meinen, dass die Abschaffung des Fachs Schweizergeschichte längst fällig gewesen sei und so endlich die rechten und nationalen Irrköpfe historischer «Wahrheiten» zum Verstummen gebracht worden wären. Das Gegenteil ist nämlich der Fall, wie wir in den unsäglichen historischen TV-Veranstaltungen fetischisierter Geschichtserzählungen mit Nullinformationswert überall verfolgen können. Politisch-nationale und institutionelle Geschichtsforschung hat in Kombination philsophisch-hermeneutischer Wissenschaft die grössten Denkerinnen und Denker der Vergangenheit hervorgebracht. Dass die europäischen und die schweizerischen Universitäten nun ausschliesslich pasteurisierte Technokraten mit ihren Minifächern und automatisierten Pseudo-Erkenntnissen produzieren, erfordert schon längst eine breite, heftige Bildungsdebatte, die sich übrigens auch einem oberdoofen Links-Rechts-Schema entzieht.
Wer für die Geschichtswissenschaft nach Beispielen relevanter Forschungen sucht, wird aktuell bei Philipp Blom fündig. Der hat mit den Bänden: «Der taumelnde Kontinent 1900-1904» und «Die zerrissenen Jahre 1918-1938» eine Gesamtschau der ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts dargelegt, die ihresgleichen sucht. Philipp Blom beispielsweise erzählt Geschichte inklusive Zusammenhänge und nicht einfach eine Reihe von entpolitisierten Sozialdaten, die nach Skandalisierung («Schweiz profitierte von Apartheidsregime») schreien, sondern klare Zusammenhänge von damals und heute und morgen aufzeigen. Die Österreicher mischen also noch mit auf dem grossen Parkett weltpolitischer Erzählungen...was man von der ehemals grossartigen Schweizer Geschichtsforschung wirklich nicht mehr behaupten kann.
Markus Gabriel lehrte an der New School in New York. Als er sich entschied, nach Deutschland zurückzukehren, meinte ein berühmter us-amerikanischer Hegel-Forscher zu ihm: «Why? German Geist does now reside in America.» In Analogie könnte man allen schweizerischen Geschichtsforschenden, die es verstehen, Politik- und Sozialgeschichte so zu erzählen, dass sie grandiose Gesamtschauen zum «schweizerischen» Europa oder zur «europäischen» Schweiz ermöglichen, empfehlen: «University of Zurich? No way. Swiss Geist resides everywhere else...»