|
Sonntag, 2. Juli 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Zahl der Working Poor nimmt leicht abNeuenburg - Der Anteil der so genannten Working Poor an der Erwerbsbevölkerung hat von 2000 bis 2007 leicht von 5 auf 4,4 Prozent abgenommen. Vor allem bei Alleinerziehenden und kinderreichen Familien reicht das Einkommen häufig nicht fürs Auskommen.ht / Quelle: sda / Dienstag, 21. April 2009 / 14:11 h
Wie aus den aktualisierten Zahlen des Bundesamtes für Statistik hervorgeht, folgt die Quote der Working Poor mit einer gewissen Verzögerung dem Konjunkturverlauf. 2000 bis 2002 sank nach Jahren günstiger Konjunktur und einem Rückgang der Arbeitslosigkeit der Anteil der Working Poor von 5 auf 3,9 Prozent.
Danach stieg die Arbeitslosenquote wieder. Die Working-Poor-Quote schwankt seither um 4,5 Prozent. Als Working Poor werden Erwerbstätige bezeichnet, die in einem Haushalt leben, dessen Gesamteinkommen trotz eines Vollzeitpensums unterhalb der Armutsgrenze liegt.
Alleinerziehende und Paare mit mehreren Kindern zählen häufiger zu den Working Poor. /
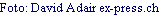 Höher als die Working Poor-Quote liegt die Armuts-Quote. Der Anteil der Personen, die in einem Haushalt unter der Armutsgrenze leben, an der Erwerbsbevölkerung schwankt seit 2004 um 9 Prozent. Männer-Anteil leicht höher Kinder erhöhen das Risiko, in einem Working Poor-Haushalt zu leben: Während bei Alleinstehenden der Anteil der Working Poor unter 2 Prozent liegt, ist er bei Alleinerziehenden mit fast 10 Prozent und bei Paaren mit drei Kinder und mehr mit 18 Prozent besonders hoch. Bei Männern ist der Working-Poor-Anteil etwas höher als bei Frauen. Bei Ausländern ist die Working Poor Quote mit fast 8 Prozent mehr als doppelt so hoch wie bei Schweizern. Besonders stark vertreten unter den Working Poor sind auch Personen mit dünnem Schulsack, Selbständige sowie Personen mit befristetem Arbeitsvertrag und Unterbrüchen in der Berufslaufbahn.
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|