|
Mittwoch, 6. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Verhärtete Fronten zum Endlager-Konzept des BundesBern - Am Ende der ersten Etappe zur Suche eines Endlagers für radioaktive Abfälle sind die Fronten verhärtet: Tausende Bewohner betroffener Regionen wehren sich gegen das Atommüll-Konzept des Bundes. Dieser will im nächsten Jahr die Mitwirkungs-Möglichkeiten ausweiten.fest / Quelle: sda / Dienstag, 30. November 2010 / 16:35 h
Im Zentrum der zweiten Etappe stehe die Partizipation, sagte Michael Aebersold, zuständiger Projektleiter beim Bundesamt für Energie (BFE), am Dienstag der Nachrichtenagentur SDA. Dabei gehe es etwa darum, wo genau die Entsorgungsanlagen gebaut werden könnten. Je nach Standort kämen dafür bis zu 47 Gemeinden in Frage.
Weiter will das BFE eruieren, welche wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen ein Atommüll-Lager auf die Standortregionen hätte. Auch zu dem Thema würden die Regionen befragt, erklärte Aebersold.
Eins ist klar: Der Dreck, den man selbst produziert, muss im eigenen Land bleiben. /
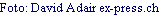 Mitwirkung bedeute jedoch nicht automatisch Mitsprache, machte er klar. Die zweite Etappe dauert voraussichtlich bis 2015/16. Bis dann soll die Auswahl der möglichen Standorte auf mindestens zwei für die Lagerung von schwach- und mittelradioaktiven sowie mindestens zwei von hochradioaktiven Abfällen eingeengt werden. Heute stehen sechs Möglichkeiten zur Diskussion: die Regionen Bözberg (AG), Jura-Südfuss (AG), Nördlich Lägeren (AG und ZH), Südranden (SH), Wellenberg (NW und OW) und Zürcher Weinland (ZH und TG). Umstrittene Partizipation Nichts übrig für das Partizipationsverfahren hat der Direktor der Schweizerischen Energie-Stiftung (SES), Jürg Buri: «Das Verfahren ist eine scheindemokratische Alibiübung», sagte er zur Nachrichtenagentur SDA. Die Bewohner der betroffenen Regionen dürften sich zwar äussern, am Schluss habe ihre Kritik aber kein Gewicht. «25 Kantone können einem einzigen ein Endlager aufzwingen», hielt Buri fest.4000 Briefe Mit Unterstützung der SES protestierten im Rahmen der Vernehmlassung zur ersten Etappe 4000 Bewohner betroffener Gebiete mittels schriftlicher Einsprachen. Weiter gingen rund 200 Stellungnahmen von Parteien, Organisationen oder Gemeinden beim BFE ein, wie Aebersold sagte.
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|