|
Donnerstag, 7. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Erstmals Online-Wörterbuch der Gebärden in drei SprachenLausanne - Am Samstag, 30. April, wird ein neues Lexikon der Gebärdensprache im Internet aufgeschaltet. Rund 1000 Gebärden werden darin in die Sprachen Deutsch, Französisch und Italienisch übersetzt.fest / Quelle: sda / Dienstag, 26. April 2011 / 17:30 h
«Es ist ein Pionierprojekt, ein historischer Moment», sagte Tiziana Rimoldi vom Schweizerischen Gehörlosenbund (SGB) am Dienstag vor den Medien in Lausanne. Künftig würden Gehörlose und ihre Angehörigen, aber auch Fachpersonen, Dolmetscher sowie das breite Publikum leichteren Zugang zu der Gebärdensprache haben.
Das Wörterbuch erlaube es, die Gebärdensprache zu festigen und zu vereinheitlichen, sagte Rimoldi. Es soll immer weiter aktualisiert werden. Kurze Filmsequenzen zeigen, wie ein Wort in der Gebärdensprache korrekt verwendet wird. Dazu kann ein weiterer Film geschaut werden, worin das Wort in einem Satz gezeigt wird.
«Das ist eine einzigartige Hilfe für Familien», sagte Pauline Padonou Loko, Mutter eines neunjährigen gehörlosen Kindes. Das Kind könne damit die Zeichen besser lernen. Auch seine Lehrer, Grosseltern und Freunde könnten von der Seite profitieren.
Regionale Eigenheiten Im Wörterbuch sind auch verschiedene regionale Eigenheiten berücksichtigt. Das Wörterbuch erlaubt es, die Gebärdensprache zu festigen und zu vereinheitlichen. /
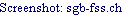 Es gibt zum Beispiel fünf verschiedene Arten, das Wort «Brot» zu zeigen: In Bern, Zürich, Basel, Luzern und St. Gallen wird das Wort unterschiedlich gebraucht. Die Dialektversionen sind auch in Filmsequenzen festgehalten. Das Wörterbuch solle auch als historisches Gedächtnis dienen, sagte Rimoldi. «Gewisse Zeichen, die nur noch ältere Leute brauchen, drohen verloren zu gehen.» Mit dem Lexikon könne die Geschichte der Gebärdensprache in der Schweiz erhalten bleiben. «Die fünfte Landessprache» Der Gehörlosenbund hofft auch, mit dem Lexikon die Zeichensprache bekannter zu machen. «Sie ist die fünfte Landessprache. Man muss an die Gehörlosen denken wie an andere sprachliche Minderheiten», forderte Rimoldi. Für Gehörlose seien Deutsch, Französisch und Italienisch Zweitsprachen. Das Wörterbuch-Projekt kostete fast eine Million Franken. Finanziert wird es durch den SGB, die Dachorganisation der Gehörlosen und Hörbehinderten-Selbsthilfe. Deren Budget besteht zu einem Drittel aus staatlichen Subventionen und zu zwei Dritteln aus Spendengeldern. Links zum Artikel:
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|