|
Mittwoch, 5. Juli 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Dem Einfluss von Feinstaub und Wolken auf der SpurWie Wolken und Feinstaubpartikel die Erdatmosphäre beeinflussen ist in vieler Hinsicht unklar. Die komplexen Zusammenhänge sind auch in Klimamodellen nur schwer vorhersagbar. Ein neues EU-Forschungsprojekt will nun genauer klären, welche Rolle Wolken und Feinstaub für das Klima spielen.Dr. Miriam Kübbeler / Quelle: ETH-Zukunftsblog / Donnerstag, 6. Februar 2014 / 10:33 h
Natürliche und menschgemachte Feinstaubpartikel - auch Aerosole genannt - und Wolken beeinflussen den Wärmehaushalt der Atmosphäre auf vielschichtige Weise. Auf der einen Seite reflektieren Aerosole einen Teil des einfallenden Sonnenlichts und kühlen so die Atmosphäre ab. Auf der anderen Seite haben diese Partikel auch einen wärmenden Effekt, da sie die Wärmestrahlung der Erde aufnehmen und wieder zurückwerfen. Des Weiteren spielen Aerosole eine wichtige Rolle bei der Wolkenbildung. Auch Wolken wirken sich unterschiedlich auf die Atmosphäre aus: Hohe Wolken erwärmen die Erde tendenziell, während tief liegende eher zu einer Abkühlung führen.
Hoher Forschungsbedarf Die komplexen Wechselwirkungen von Aerosolen und Wolken mit der Atmosphäre sind mitunter die grössten Unsicherheitsfaktoren in Klimamodellen - der letzte IPCC-Bericht bestätigt dies. So stehen Klimawissenschaftler vor einigen unbeantworteten Fragen: Welche Rolle spielen Feinstaubpartikel bei der Wolkenbildung, und wie genau beeinflussen Feinstaub und Wolken das Klima? Wie empfindlich reagieren Gebiete wie der Amazonas, wenn die globale Feinstaubbelastung weiter zunimmt? Und wie genau sah die Feinstaubverteilung vor 150 Jahren aus, also bevor der Mensch begann, die Luft durch Industrie und Verkehr zu belasten? Solchen und weiteren grundlegenden Fragen widmet sich das Projekt «BACCHUS» (Impact of Biogenic versus Anthropogenic emissions on Clouds and Climate: towards a Holistic UnderStanding). Miriam Kübbeler ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Atmosphäre und Klima and der ETH Zürich. /
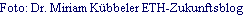 Natürliche und menschgemachte Feinstaubpartikel und Wolken beeinflussen den Wärmehaushalt der Atmosphäre.(Symbolbild) /
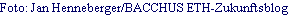 Prof. Ulrike Lohmann vom Institut für Atmosphäre und Klima (IAC) der ETH Zürich leitet dieses EU-Rahmenforschungsprogramm, in dem 20 Forschungseinrichtungen aus der EU, der Schweiz und Israel während der nächsten vier Jahre eng zusammen arbeiten. Von Messungen über Modellsimulationen... Das übergeordnete Ziel von BACCHUS ist es, die Aussagekraft der Klimamodelle zu erhöhen. Dazu gliedert sich das Grossprojekt in vier Teilschritte, die von verschiedenen Gruppen bearbeitet werden: In einem ersten Schritt erhebt man in grossangelegten Feldkampagnen Messdaten von Wolken und Aerosolen. Diese Messungen finden an Orten der Welt statt, an denen man möglichst unterschiedliche Arten von Wolken und Aerosolzusammensetzung erwartet. Die so gewonnen Daten werden anschliessend mit langjährigen Beobachtungszeitreihen von Aerosolen und Wolkeneigenschaften kombiniert. Forscher nutzen diese Messdaten dann, um allgemeingültige Beziehungen zwischen Aerosolen und Wolken aufzustellen. Das Wissen um die Wechselwirkungen soll schliesslich zuerst in räumlich begrenzten Modellen und später in umfassenden Klimamodellen angewendet werden. ...hin zu politischen Richtlinien Ein tieferes Verständnis von Aerosol-Wolken-Wechselwirkungen kann einerseits Klimaprojektionen zuverlässiger machen. Andererseits können solche Einsichten - kombiniert mit besseren Klimaprognosen - Entscheidungsträgern in Industrie und Politik helfen, sowohl Strategien und Richtlinien für die Luftreinhaltung als auch Massnahmen gegen den Klimawandel zu entwickeln.
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|