|
Montag, 4. Dezember 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Die Seelsorge ist zu säkularisierenDie Kirche sieht Seelsorge als ihr Kerngeschäft, und der weltliche Staat sichert ihr dazu ein öffentliches Monopol. Es ist an der Zeit, die Form dieses staatlichen Outsourcings zu überdenken.Andreas Kyriacou / Quelle: news.ch / Donnerstag, 10. April 2014 / 10:17 h
Seelsorge ist, besonders unter dieser Bezeichnung, eine traditionell kirchliche Domäne. Die einzelnen Religionsgemeinschaften schneidern ihr diesbezügliches Angebot grösstenteils für die eigenen Mitglieder zurecht. Das ist zweifelsohne sinnvoll. Wer guter Hoffnung ist, dass ein Pfarrer oder ein Priester Trost spenden oder Rat geben kann, dem soll dieses Angebot zur Verfügung stehen. Es zu schaffen, liegt in der Verantwortung seiner Gemeinschaft.
Es gibt aber sehr wohl auch seelsorgerische Angebote, die sich nicht nur an die eigenen Gläubigen richten. Auch gegen derlei Angebote ist grundsätzlich nichts einzuwenden - im Gegenteil: nur wenn eine Organisation ein Angebot für Aussenstehende hat, kann sie sich mit halbwegs gutem Gewissen als «gemeinnützig» bezeichnen.
Es gibt aber einen Bereich, der überdacht werden muss: die Seelsorge mit staatlichem Auftrag. In den meisten Kantonen stellen die reformierte und die römisch-katholische Kirche in Spitälern und Gefängnissen im Auftrag der öffentlichen Hand Seelsorger. Sie sind auch dort primär Anlaufstellen für Mitglieder der jeweils eigenen Gemeinschaft. Diese Rolle sollen sie ausüben können, wenn Insassen nach ihnen verlangen.
Problematisch ist allerdings, dass die beiden - eher ehemals grossen - Landeskirchen mit staatlichem Auftrag zumeist auch als alleinige und offizielle Anlaufstelle für konfessionsfreie Personen und für Mitglieder anderer Religionsgemeinschaften amten. Zugegeben, in einigen Kantonen darf auch ein Christkatholik, ein Rabbi oder ein Imam «seine» Schäfchen besuchen. Doch selbst dort, wo eine gewisse Öffnung erfolgt ist, herrscht oft keine Gleichbehandlung. Oftmals stehen Vertretern der Landeskirchen spezielle Räume zur Verfügung oder sie dürfen in Gefängnissen Insassen in ihren Zellen aufsuchen und nicht nur in den öffentlichen Räumen.
Die seelsorgerischen Exclusivrechte in Spitälern gehören abgeschafft. /
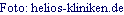 Für Personen, die mit jemandem mit weltlichem Hintergrund sprechen möchten, schafft der Staat keinerlei Angebote. In aller Regel werden die Kirchen von der öffentlichen Hand mit grosszügigen Pauschalen für ihre Dienste entschädigt. Im Kanton Zürich beispielsweise erhalten die Landeskirchen und die beiden anerkannten jüdischen Gemeinschaften zusammen Jahr für Jahr 50 Millionen Franken, ohne Zweckbindung. Die seelsorgerischen Tätigkeiten werden so faktisch grosszügig vergütet. (Dennoch werden sie bei der aktuellen Debatte zur Initiative zur Abschaffung der Zwangskirchensteuern für Firmen und Vereine ins Feld geführt. Und natürlich bleiben auch zahlreiche Personen Kirchenmitglieder, weil sie meinen, sie zahlten mit ihren Kirchensteuern vorwiegend Gemeinnütziges. In Wirklichkeit fressen Kultus und Administration rund 70% der Kirchenbudgets.) Die amtlichen Seelsorger unterstehen der Schweigepflicht. In Gefängnissen können sie gerade deshalb für einzelne Personen zu einer wichtigen Anlaufstelle werden. Auch deshalb ist es essentiell, dass die Zwangsverquickung der Rolle des Seelsorgers und der des Kirchenrepräsentanten aufgehoben wird. In Spitälern ist die Rolle des amtlichen Seelsorgers noch aus einem weiteren Grund heikel: Das Outsourcing der «Seelenpflege» an die Kirchen entwertet die Rolle der Mediziner und Pflegepersonen. Es entsteht eine künstliche Trennlinie zwischen körperlicher und psychologischer Betreuung. Dabei ist es essentiell, dass Patienten eine rundum professionelle Betreuung erhalten. Auch hier hat die Religion erst mal nichts zu suchen. Wenn jemand zusätzlich seelsorgerische Betreuung haben will, soll er oder sie dies beanspruchen können. Als alternativlose Angebote ist kirchliche Seelsorge aber nicht länger tragbar.
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|