|
Samstag, 1. Juli 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Ständerat will auch kleinste Wasserkraftwerke fördernBern - Auch kleinste Wasserkraftwerke sollen gefördert werden. Das hat der Ständerat am Dienstag im Rahmen der Beratungen zur Energiestrategie beschlossen. Er kehrte in diesem Punkt zur Bundesratsversion zurück.bg / Quelle: sda / Dienstag, 22. September 2015 / 11:44 h
Heute gibt keine Untergrenze. Geht es nach dem Bundesrat und dem Ständerat, sollen künftig nur noch Wasserkraft-Anlagen mit einer Leistung von mehr als 300 Kilowatt gefördert werden. Der Nationalrat hatte die Grenze höher gesetzt, bei 1 Megawatt. Die Mehrheit befand, Kleinstwasserkraftwerke hätten im Verhältnis zum Eingriff in die Natur einen geringen Nutzen.
Im Ständerat setzte sich Werner Luginbühl (BDP/BE) vergeblich für die höhere Untergrenze ein. 99 Prozent der Wasserkraftwerke hätten mehr Leistung als 1 Megawatt, gab er zu bedenken. Würde die Grenze dort gesetzt, würden die 100 kleinsten Anlagen nicht mehr unterstützt. Diese beanspruchten viele Fördergelder und weckten grosse Widerstände, nicht nur bei Umweltorganisationen.
Im Interesse der Fische «Wir setzen bei Kleinstkraftwerken viel Geld ein für wenig Leistung und richten damit viel Flurschaden an», sagte Luginbühl. Auch Roberto Zanetti (SP/SO) warb für die höhere Untergrenze, «im Interesse der Fische und auch der Fischer». Nicht jeder Flusslauf sollte verbaut werden. Die Mehrheit im Ständerat war aber der Ansicht, auch die Produktion vieler Kleinstanlagen lohne sich in der Summe. Sonst bräuchten auch kleine Photovoltaik-Anlagen nicht gefördert zu werden, gab Werner Hösli (SVP/GL) zu bedenken.Auch kleine Wasserkraftwerke lohnen sich. /
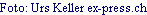 Wolle man den Ausstieg aus dem Atomstrom bewerkstelligen, müsse die Wasserkraft ausgebaut werden. Der Rat sprach sich mit 25 zu 18 Stimmen dafür aus, die Grenze bei 300 Kilowatt zu setzen. Energieanlagen auch in Naturschutzgebieten Weiter hat der Ständerat am Dienstag entschieden, dass Windturbinen, Wasserkraftwerke oder Pumpspeicherkraftwerke künftig unter Umständen auch in Naturschutzgebieten gebaut werden dürfen. Konkret soll die Nutzung von erneuerbaren Energien zum nationalen Interesse erklärt werden. Damit wäre eine Güterabwägung möglich, wenn es um den Bau von Anlagen in Landschaften von nationaler Bedeutung geht. Der Ständerat folgte in diesem Punkt grundsätzlich dem Bundesrat und dem Nationalrat, schränkte aber die Güterabwägung etwas ein: Diese soll nur möglich sein, wenn das Schutzgebiet nicht «im Kern seines Schutzwertes verletzt wird». Energieministerin Doris Leuthard stellte fest, dabei handle es sich um unbestimmte Rechtsbegriffe. Was zum Kern eines Schutzgebietes gehöre und ob dieser durch eine Energieanlage verletzt würde, müsste wohl im Einzelfall geklärt werden. Im Sinne einer Konzession an die Umweltverbände zeigte sich Leuthard aber einverstanden mit der Ergänzung.Bessere Rahmenbedingungen Geregelt hat der Ständerat ferner die Abnahme- und Vergütungspflicht durch Netzbetreiber. Das Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für die Produktion aus erneuerbaren Energien zu verbessern: Diese sollen in jedem Fall einen Abnehmer haben, der ihnen einen angemessenen Preis bezahlt. Der Ständerat ist hier wieder näher an die Version des Bundesrates gerückt. Bei den Regeln zum Eigenverbrauch hat er indes eine Klausel eingefügt, wonach sich Endverbraucher zum Eigenverbrauch zusammenschliessen können. Sie hätten zusammen nur einen Zähler und würden vom Netzbetreiber wie ein Endverbraucher behandelt.
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|