Patrik Etschmayer / Quelle: news.ch / Mittwoch, 28. April 2010 / 10:56 h
Mit der Moral ist es so eine Sache. Sie wird gerne als Totschlagargument verwendet. Sei es nun beim Sexualverhalten oder bei anderen sozialen Beziehungen. Dass die Hüter der Moral dabei selbst vielfach Dreck am Stecken haben, ist aber auch nichts Neues.
Doch manche moralische Normen sind tief und unabhängig von Autoritätspersonen und kulturellem Hintergrund verankert. Zum Beispiel das Gefühl für Fairness. Bereits Kapuzineräffchen werden ziemlich sauer, wenn sie ungerecht behandelt werden. Bekommt im Versuchslabor das eine Äffchen im Tausch gegen ein Granitsteinchen ein Stück Gurke, ein anderes hingegen eine viel begehrtere Weintraube, verweigert sich das erste Äffchen, in Zukunft das Steinchen zu geben, obwohl es eigentlich auch Gurke mag.
Bei sozialen Lebewesen herrscht deshalb meist ein Übereinkommen, das dafür sorgt, dass im Austausch miteinander eine gewisse Fairness herrscht. Nettigkeiten werden mit Gefallen vergolten, wer interagiert, erwartet vom Gegenüber nicht belogen zu werden. Dass jeder einen gewissen Vorteil für sich suchen darf, ist dabei in Ordnung. Wer allerdings den Bogen überspannt und andere ausnützt oder betrügt, muss mit Sanktionen rechnen... womöglich sogar dem Ausschluss aus der Gemeinschaft.
Politiker räumten einst Hürden aus dem Weg
Die Senatoren am Goldman-Sachs-Hearing waren sich über Parteigrenzen hinweg ziemlich einig, dass Goldman Sachs sämtliche moralische Grenzen der grundsätzlichsten Natur hinter sich gelassen hatte, als es seinen Kunden mit höchster Priorität Investment-Produkte empfahl, die in einer internen E-Mail auf höchster Management-Ebene als «beschissen» (shitty) bezeichnet worden war und auf deren Absturz Goldman Sachs scheinbar spekulierte.



Der Kapuzineraffe: Ein Vorbild in Sachen Fairness für Banker? /
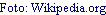

Die Senatoren prügelten verbal auf die Banker ein und konfrontierten diese mit ihren eigenen Mails. Einer zum Beispiel schrieb, er habe «Witwen und Waisen Produkte eines kollabierenden Marktes verkauft, die nichts als intellektuelle Masturbation seien.»
Verkommene Moral? Sicher. Und jetzt ist die Politik endlich auf der Jagd nach diesen Finanz-Verbrechern. Doch erinnern wir uns an 2007, als alle Märkte noch in den Himmel wuchsen und eine Rezession undenkbar schien. Verantwortlich für den unglaublichen Wachstum jener Jahre war das Kapital der Blase, waren die unhaltbaren Versprechen, die fast jeder gerne glauben wollte. Und jene, die nicht mehr daran glaubten – wie scheinbar auch Goldman Sachs, die den damaligen Immobilienmarkt schon als tot betrachteten, machten trotzdem weiter. Denn in den Zeiten des Booms fragte kaum jemand nach dem «Danach» und die Politik räumte jede erdenkliche Hürde für die Banken aus dem Weg. «Regulierung» existierte damals nur mit der Vorsilbe «De».
Grundsätzliche moralische Wegweiser
Die Goldman-Sachs-Manager handelten allem Anschein nach unmoralisch. Sollten die Anschuldigungen der Insider-Deals und der bewussten Irreführung der Kunden zutreffen, dann müssen diese Leute auch bestraft werden. Aber der Aufstieg dieses Systems und die damit im Zusammenhang stehende moralische Korruption sind während Jahren von weiten Teilen der Gesellschaft als ein notwendiges Übel für Wohlstand und Wachstums akzeptiert worden.
Es dürfte kein Zufall sein, dass Goldman Sachs auch schon wieder in das nächste Finanz-Erdbeben – die Griechenland-Krise - verwickelt ist. Neben der Aufklärung der ganzen nebulösen Geschäfte wäre es nun wohl vor allem wichtig, grundsätzlichste moralische Wegweiser in der Wirtschaft auch für Grossbanken wieder aufzustellen, die auf ganz einfachen Prinzipien wie: «Ich belüge nicht meine Kunden», oder «Ich helfe niemandem beim fälschen und täuschen» heissen könnten. Allzu schwierig dürfte das wohl nicht sein... oder will jemand behaupten, dass wir tiefer angesiedelt sind als Kapuzineräffchen?