|
Sonntag, 2. Juli 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
ETH braucht mehr Geld für ForschungBern - Um ihre internationale Spitzenposition zu behaupten, brauchen die Eidgenössisch Technischen Hochschulen (ETH) und ihre Forschungsanstalten mehr Geld. Der ETH-Rat verlangt für die Jahre 2012 bis 2016 vom Bund eine jährliche Budgeterhöhung von mindestens sechs Prozent.ade / Quelle: sda / Donnerstag, 28. Oktober 2010 / 14:15 h
Die Konkurrenz werde härter, sagte Fritz Schiesser, Präsident des ETH-Rats, am Donnerstag vor den Medien in Bern. Zahlreiche Länder, zum Beispiel die Nachbarstaaten Deutschland und Frankreich, investierten erkleckliche Summen in die Bildung, Forschung und Innovation.
Um mithalten zu können, benötige der ETH-Bereich bis 2016 jährlich mindestens sechs Prozent mehr Geld. Zum ETH-Bereich gehören neben der ETH Zürich und der ETH Lausanne die vier Forschungsanstalten PSI, WSL, Empa und Eawag. Sie erhalten heute einen Bundesbeitrag von rund zwei Milliarden Franken pro Jahr.
Immer mehr Studenten Jährlich mindestens zwei Prozent mehr Bundesbeiträge brauchen die ETH für die Lehre: Wie Ralph Eichler, Präsident der ETH Zürich, sagte, ist die Zahl der Studierenden in den letzten zehn Jahren viel stärker angestiegen als die Bundesbeiträge. Um die Qualität der Ausbildung aufrecht zu erhalten, benötigten die ETH nun mehr Mittel. «Wir wollen keine Konzessionen machen bei der Ausbildung und den Betreuungsverhältnissen», sagte Schiesser. Bleibt das Geld aus, müssen laut dem ETH-Rat deshalb Wege gefunden werden, um die Zahl der Studierenden zu beschränken. Es bräuchte dann legale Mittel, um die Studenten auswählen zu können, sagte Eichler. Ein bis zwei Prozent mehr Geld sind laut dem ETH-Rat nötig, um die Arbeitsbedingungen für die Angestellten wettbewerbsfähig zu halten. Die Konkurrenz mit der Privatwirtschaft sei hart.Der ETH-Rat verlangt deutliche Erhöhung des Forschungsbudgets. /
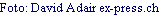 Zudem wolle der ETH-Rat in die Chancengleichheit investieren: Bis 2016 etwa sollen ein Viertel der Führungspositionen durch Frauen besetzt sein. Von Nanotechnik bis Umweltschutz Mindestens drei Prozent muss das Budget pro Jahr wachsen, damit grosse, strategisch wichtige Forschungsvorhaben angepackt und weitergeführt werden können. Der ETH-Rat hat für die nächsten Jahre die Förderung von fünf thematischen Schwerpunktgebieten und drei Grossforschungsprojekten beschlossen. Die Schwerpunkte sollen zum Beispiel Schlüsseltechniken der Zukunft wie die Robotik oder die Nanotechnik weiterentwickeln, wie Joël Mesot, Direktor des Paul Scherrer Instituts (PSI), sagte. Auch Umwelt und Energie gehören zu den Schwerpunktthemen. Drei Grossforschungsanlagen erfordern eine enorm leistungsfähige Infrastruktur: In Lugano will die ETH Zürich ein Rechenzentrum errichten, das von Forschern verschiedenster Fachrichtungen benutzt werden kann. Der Supercomputer soll künftig zum Beispiel ganz präzise Erdbebensimulationen durchrechnen.Ein künstliches Gehirn Das Projekt «Blue Brain» an der ETH Lausanne hat zum Ziel, das menschliche Hirn künstlich nachzubauen. Dereinst könne dies zeigen, wie das menschliche Hirn funktioniert und wie es bei manchen Menschen Krankheiten auslöse, sagte Philippe Gillet, Vizepräsident für akademische Angelegenheiten der ETH Lausanne. Das dritte Grossprojekt soll am PSI in Villigen AG zu stehen kommen. Der Röntgenlaser SwissFEL wird in einer 700 Meter langen Beschleunigungsanlage extrem kurzes und intensives Röntgenlicht erzeugen. Damit lässt sich quasi in Echtzeit filmen, wie sich chemische Moleküle oder Bestandteile biologischer Zellen verändern.
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|