|
Montag, 3. Juli 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Links-Grün und C-Parteien wollen Streumunition bannenBern - Ein Verbot von Streumunition stösst bei den meisten Parteien auf Sympathie. Einzig FDP und SVP lehnen die Ratifikation eines internationalen Übereinkommens ab. Die SVP ist grundsätzlich dagegen; die FDP sagt zwar «grundsätzlich» Ja zu einem Verbot, will aber dennoch das Abkommen ablehnen.fkl / Quelle: sda / Donnerstag, 24. Februar 2011 / 09:13 h
SVP und FDP erklärten in ihrer Vernehmlassungsantwort, die Armee werde in ihrer Verteidigungsbereitschaft geschwächt, wenn sie ihre Streumunition binnen acht Jahren vernichten müsse. Die Schweiz hat rund 200'000 Streubomben mit jeweils 30 bis 80 Sprengsätzen (Bomblets) pro Bombe.
Mit der Vernichtung der Schweizer Kanistermunition, die unter das Verbot falle, werde die Artillerie stark eingeschränkt, bei einem Angriff «Ziele mit panzerbrechenden Mitteln bekämpfen zu können», schreibt die SVP. Die FDP möchte zuerst einen Entscheid über Alternativen für die Streumunition, bevor sie einer Ratifikation zustimmt.
Gefahr für die Bevölkerung Die Befürworter eines Verbots - SP, CVP, Grüne, CSP und der Gewerkschaftsbund (SGB) - bezweifeln dagegen den militärischen Nutzen von Streubomben für die Schweiz. In einem dicht besiedelten Land würden diese vor allem die eigene Bevölkerung gefährden, schreiben SP und SGB. Die Befürworter wollen mit der Ratifikation auch international ein Zeichen setzen.Die Befürworter des Verbots glauben, dass Streumunition vor allem die eigene Bevölkerung gefährde. /
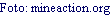 Streumunition stelle «wegen der hohen Blindgängerrate ein ernsthaftes humanitäres Risiko» vor allem für Zivilisten dar, schreibt die CVP. Streubomben seien «menschenverachtend», so die Christlich-soziale Partei (CSP). Streit um Kosten SVP und FDP wiederum kritisieren die Kosten einer vorzeitigen Vernichtung als zu hoch. Sie verlangen, die Kanistermunition erst dann zu vernichten, wenn diese ihr Verfallsdatum erreicht hat. Die CVP will, um Kosten zu sparen, die Streumunition im Ausland vernichten lassen. Den Grünen ist es einerlei, ob im In- oder Ausland vernichtet wird: Man wolle den Entscheid dem Bundesrat überlassen. Dagegen wollen CSP, SP und SGB eine Vernichtung im Inland und führen dafür Gründe der Sicherheit sowie des Umweltschutzes an. Aber auch die Befürworter eines Verbots sehen eine Schwäche in der Konvention: Die grossen Produzenten von Streumunition - die USA, Russland, China, Israel, Indien und Pakistan - wollen das Verbot nicht mittragen. Deshalb fordern die Befürworter den Bundesrat auf, dass er sich dafür einsetzt, dem Übereinkommen international zum Durchbruch zu verhelfen.
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|